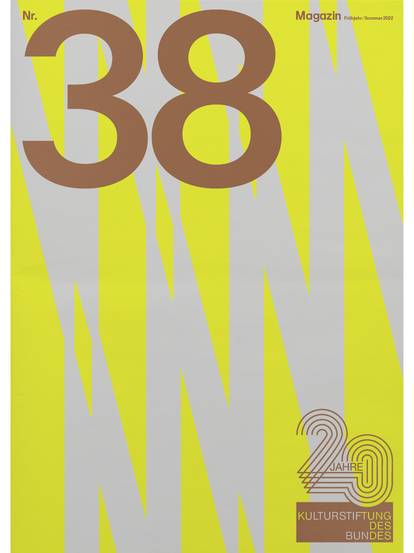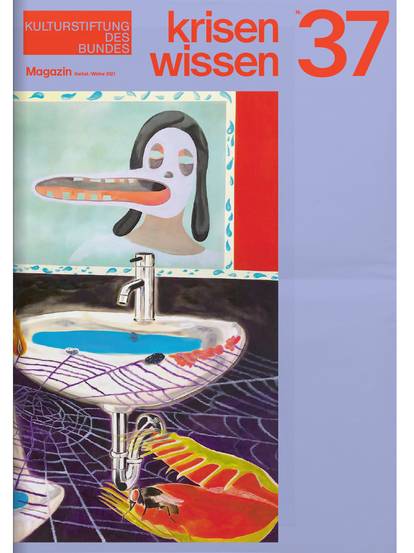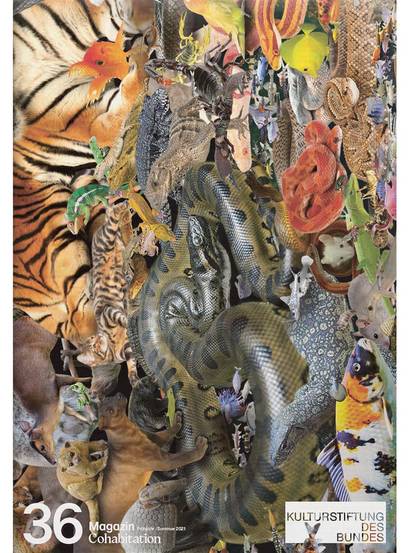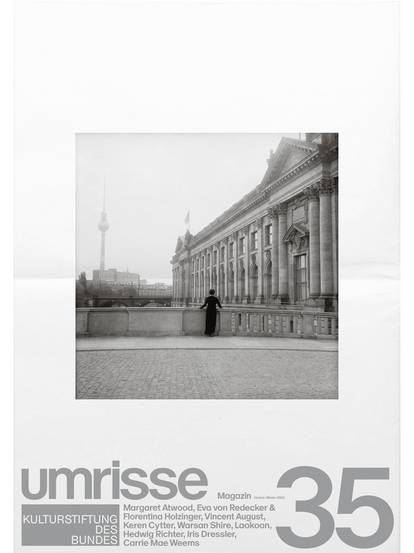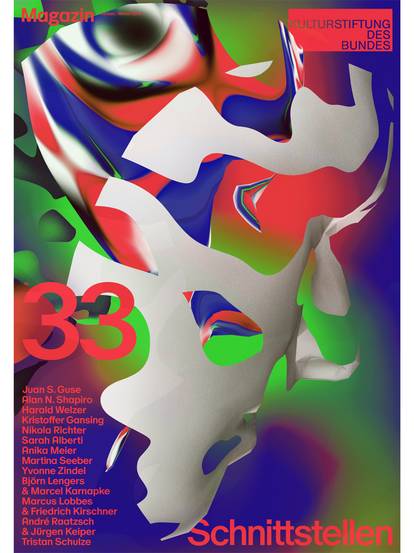Der Kultur- und Rechtswissenschaftler Jedediah Purdy (JP) ist ein Theoretiker der Klimakrise — und gibt sich als solcher keinen Illusionen hin. Nur durch tiefgreifende Einschnitte in unsere Lebensweise könne es den westlichen Demokratien gelingen, an einer fairen Verteilung der Ressourcen auf dem Planeten mitzuwirken. Jedoch ist er auch zuversichtlich: Die Menschen hätten ihr Verhältnis zur Natur bereits so oft neu imaginiert — warum sollte uns gerade jetzt die dringend nötige Vorstellungskraft ausgehen? Ein Plädoyer für den Mut zum kulturellen Wandel.
---
Herr Purdy, aktuell drehen sich viele Debatten der Klimakrise um den Erhalt und den Schutz der Natur. Sie argumentieren, dass dieses Ziel eine Wunschvorstellung sei, die wenig mit unserer tatsächlichen Situation auf dem Planeten zu tun habe. Inwiefern müssen wir unsere Vorstellungen anpassen?
JP Eine wichtige Rolle spielt in der Umweltpolitik die Vorstellung, die Natur sei rein und unberührt gewesen, bevor wir sie zerstört hätten. Diese Vorstellung ist eine Romantisierung aus einer privilegierten Perspektive. Sie blendet in ihrer Imagination einer ganzheitlichen Harmonie die gegenseitige Abhängigkeit und die Konkurrenz aus, die um das Überleben auf diesem Planeten akut herrscht und immer schon eine Rolle gespielt hat. Für den Menschen ging es immer um die Bearbeitung von Lebensraum und um den Zugang zu Ressourcen – und damit für viele auch um einen Überlebenskampf.
Aber man kann das Verhältnis auch technischer beschreiben: Wir haben das Anthropozän oder das Zeitalter der Menschheit erreicht, in dem alle Lebenswelt fortlaufend durch menschliches Handeln verändert wird. Für jeden Einzelnen von uns stehen circa 2.000 Tonnen bebauter und transformierter Umwelt zur Verfügung. Über diesen Lebensraum sollten wir nachdenken, in ihm liegen die politischen Aufgaben unserer Zukunft. Denn diese hergestellte Welt der menschlichen Gesetze, der Städte, der Transportnetze und der Energiesysteme ist der Ort, an dem wir eine Gerechtigkeit unter den Menschen und mit den anderen Spezies dieses Planeten werden herstellen müssen. Alle Entwicklungen darin machen bestimmte Personengruppen mächtig und andere vulnerabel. Ob das nun lokal ein neues Autobahn- oder Stromversorgungsnetz ist oder global die Veränderung der Erdatmosphäre und der weltweiten Wetterverhältnisse.
Was wir für eine Umweltpolitik halten, dreht sich eigentlich um Verantwortung. Es geht darum, und das lässt sich nun nicht mehr ohne Emotionen beschreiben, wer im 21. Jahrhundert leben darf und wer sterben muss.
Müsste unsere sogenannte Umweltpolitik sich also als neue politische Ethik verstehen?
JP Sehr oft beinhaltet die Politik, die sich mit dem Verhältnis des Menschen zu seiner Lebenswelt auseinandersetzt, eine Hoffnung auf eine moralische und kulturelle Reform. Diese Hoffnungen sind ein sehr großer Bestandteil aktueller grüner Politik und gehen ideengeschichtlich Jahrhunderte zurück. Ich rechne dieser Politik hoch an, eine Auseinandersetzung mit einem Teil der menschengemachten Krisen erst ermöglicht zu haben. In dieser Hinsicht war die romantische Naturvorstellung nicht nur ein Irrtum, sondern auch eine produktive Erfindung. Gleichzeitig glaube ich nicht daran, dass etwa die Klimakrise Gelegenheit für moralische Neuerung geben wird. Zumindest in den nächsten Jahrzehnten werden wir vor allem harte Einschnitte in unsere gewohnte Lebensweise erleben. Mit dem rasanten Tempo eines kurzfristigen Verlustgefühls kann kein moralischer Wandel Schritt halten.
Worauf sollten wir dann setzen, wenn nicht auf Moral in der Krise?
JP Wenn sich Menschen dem Fortschreiten der Klimakrise tagtäglich stellen müssen, dann müssen sie grundlegend neue Erzählungen entwickeln, was Natur und unser Leben mit ihr ausmacht. Die Bewältigung kommender Krisen wird u. a. stark von der Kraft dieser Selbsterzählungen abhängen. Und um sie zu entwickeln, brauchen wir, hier wird es fast schon dialektisch, starke physische Vorbilder aus unserer realen Umwelt. Ein historisches Beispiel dafür ist die stark romantisierte, aber auch sehr produktive Politik der Wildnis in der US-Geschichte des 20. Jahrhunderts. Gegenwärtig gibt es rund 445.000 Quadratkilometer Land, die dem Wildnis-Statut von 1964 unterliegen und die nicht maschinell bearbeitet werden. Das bringt messbare ökologische Gewinne. Dieser Wildnisstatus hätte sich niemals so durchsetzen lassen, wenn es in den USA während derselben Jahrzehnte nicht eine so hohe Wertschätzung für Nationalparks gegeben hätte. Die Nationalparks, mit ihrer etwas kruden ästhetischen Verbindung aus Vorstellungen der europäischen Romantik, den Idealen des amerikanischen Westens und des republikanischen Patriotismus, wurden zum produktiven, vielversprechenden Vorbild für eine neue progressive staatliche Bodenpolitik. Solche Bilder brauchen wir auch für unser heutiges Krisenmanagement.
Wie könnten solche Bilder aussehen?
JP Um unser Denken für die aktuellen Krisen zu rüsten, brauchen wir komplexere Bildwelten als die der Nationalparks, welche die sonst abstrakten politischen Zusammenhänge sichtbar machen: eine Art Welttheater. Nahrungskreisläufe und unsere Methoden der globalen Nahrungsmittelproduktion wären beispielsweise ein sehr passendes Sujet für dieses Theater. Niemand weiß, in welches Leid er verwickelt ist oder was er Gutes tut, bis er seinen grundlegenden täglichen Metabolismus mit der Welt verstanden hat.
Auch die Pandemie hat diese theatralen Eigenschaften. Sie hat wie ein medizinisches Kontrastmittel gewirkt, das für Untersuchungen in die Blutbahn, also in ein gesellschaftliches System, gespritzt wird und Vulnerabilität in Zeiten der Gefahr sichtbar macht.
Glauben Sie, dass wir aufgrund der Abstraktheit mancher Krisenphänomene nicht die nötige Angst verspüren, die es für konsequentes Handeln bräuchte?
JP Thomas Hobbes vertrat die These, dass die Notwendigkeit für politische Steuerung in Gemeinschaften in deren Anfälligkeit für Furcht und Angst läge. Und dass wir Institutionen erschaffen müssten, die uns dabei unterstützen, diese Angst sinnvoll zu regulieren, also auf reale Auslöser angemessen zu reagieren und unsere konfuse Angsterfahrung zu überwinden. Angst kann eine Basis für kollektive Aktionen bilden oder zu Misstrauen und Rückzug führen. Diese beiden Prozesse laufen immer parallel. Also sage ich Ja zur Angst! Wenn Angst richtig verstanden wird, lenkt sie Aufmerksamkeit auf das, was uns am wichtigsten ist. Aber wenn wir uns unserer Angst nicht bewusst werden, dann kann sie dazu verleiten, die Welt wie die Bilder eines Schattentheaters zu sehen.
Sie haben sich viel zu wahnhaften Ängsten geäußert, die in den letzten Jahren in der US-amerikanischen Gesellschaft an Einfluss gewonnen haben. Auf welche Akteure und Kräfte setzen Sie, um diesen entgegenzuwirken?
JP Erst einmal sind meine Hoffnungen begrenzt, denn in den USA sind demokratische Verabredungen für bis zu 40 Prozent der Bevölkerung nicht länger verbindlich. Ich glaube, dass diese Entwicklung zukünftig auch andere westliche Staaten betreffen könnte. Wenn ich aber doch auf etwas setze, dann auf die erlebbaren Erfolge einer neuen Realpolitik. Denn nur diese Realpolitik kann die positiven Möglichkeiten der Staatlichkeit erlebbar machen, die in der Lüge von der gestohlenen Wahl symbolisch zur Disposition gestellt wurde. Die aktuelle Regierung weiß, dass ihr nur wenig Zeit bleibt, um möglichst vielen Bürgern vorzuführen, wie funktionstüchtig dieser Staat auch in Krisenzeiten bleibt. Hier muss also eine realistische Angst vor einer autoritären Entwicklung ab jetzt Regierungshandeln und gesellschaftliche Innovation vorantreiben.
Wie müsste diese Innovation in den kommenden Jahren aussehen?
JP Wichtig sind zum einen infrastrukturelle Maßnahmen und Investitionen, deren Erfolge für alle sichtbar und motivierend sind. Der Green New Deal spielt hier eine entscheidende Rolle, weil er die soziale Dimension der Klimakrise berücksichtigt. Ebenso wichtig ist die Art der Kommunikation über die Krise. Das mag sich verrückt anhören, aber Politik auf US-Bundesebene muss endlich wieder langweiliger werden! Sie muss konkrete Probleme bestmöglich analysieren und über pragmatische Maßnahmen informieren, statt große weltanschauliche Konfliktlinien zu zelebrieren. Das wäre eine Erleichterung.
Wenn die Kommunikation in der Krise so wichtig ist, müssen wir dann nicht auch ehrlich darüber sprechen, wie unzureichend viele Maßnahmen zur Krisenbewältigung tatsächlich sind?
JP Innovation entsteht im Kleinen, Vertrauen in den Staat ebenso. Große, öffentlich zur Schau gestellte Ideale erzeugen immer Misstrauen – und nicht zu Unrecht. Klimapolitik beispielsweise wurde in der Vergangenheit entweder mit dem Framing der großen Wiedergutmachung an der Natur oder der bevorstehenden Apokalypse behandelt. Weder noch wird eintreten. Es wird eine Politik der aufeinanderfolgenden Krisen und eines Krisenmanagements geben, dem es nur gelegentlich gelingen wird, einige Dinge besser zu machen. Es kann in der Summe aber viel mehr getan werden, wenn man es kleinteiliger angeht.
Was wird das für unser individuelles Leben bedeuten?
JP Wir werden uns ökologisch gesehen privaten Wohlstand auf globalem Niveau nicht leisten können. Wofür wir aber genug verfügbare Ressourcen haben, sind öffentlicher Wohlstand und geteilte Infrastrukturen. Daher ist ein Teil meiner Vorstellung von „Commonwealth“, unser politisches Leben darauf auszurichten, gemeinschaftliche Ideen vom Umgang mit unseren Ressourcen und öffentlichen Gütern zu erzeugen.
Hier reicht es tatsächlich nicht, Veränderungen politisch pragmatisch zu steuern: Wir brauchen andere Grundsatzfragen. Ich sehe Commonwealth als etwas, das Aufmerksamkeit auf die faktische wechselseitige Abhängigkeit für unser Überleben lenkt, um konkret zu hinterfragen, was das Wirtschaftssystem überhaupt produziert. Auch, welche Art von Leben es produziert. Was für Beziehungen? Wie viel Schaden verursachen wir dadurch, dass wir darin leben? Ist es für uns möglich, in diesem System zu leben und anderen dabei zu helfen, auch gut zu leben? Und wie viel tragen wir dazu bei, das abzunutzen und wegzuessen, was für alle da ist?
Viele Menschen verbinden mit einer solchen Vorstellung von Vergemeinschaftung auch Enteignungen – und lehnen ein solches Vorgehen grundsätzlich ab.
JP Natürlich sind die Vorbehalte riesig, das ist gerade mir als Amerikaner sehr bewusst. Aber es gibt bereits ein anderes, unbelastetes Vokabular und Gedanken, die den Weg ebnen könnten. Kaum jemand stellt infrage, dass kritische Infrastruktur wie Wasserversorgung in staatlicher Hand am besten aufgehoben ist. Und im Zuge von Debatten zur Dekolonisation normalisieren wir gegenwärtig die Forderung, dass Museen und Sammler ihren Besitz an Raubgütern an die Staaten der ehemaligen Kolonien zurückgeben sollten. Wie weit ist der Weg denn eigentlich, diese Überlegungen auf knappe Ressourcen wie Grundbesitz oder auf neue öffentliche Orte wie Soziale Medien im Internet anzuwenden? Ist das so unerreichbar, so weit weg von unseren Wertvorstellungen?
Solche Wertvorstellungen entwickeln sich oft zunächst in überschaubaren Zirkeln, bevor sie in breiten Debatten aufgegriffen werden. Braucht es für die kommenden Veränderungen vor allem Vordenker oder breite Mehrheiten?
JP Ich denke, der moderne Staat mit allen seinen ökonomischen Verflechtungen ist derzeit so kompliziert strukturiert, dass Teile einer Neuausrichtung im Sinne des Commonwealth nur durch seine Regierung und Experteneinschätzungen voranzubringen sind. Die Biden-Regierung hat beispielsweise Analysten damit beauftragt, für die sinnvolle Abwägung zwischen Umwelt-, Handels- und Geldpolitik neue Modelle zu entwickeln, die nicht die Funktionsweise der Märkte doublieren, sondern Alternativen zu Kosten-Nutzen- Rechnungen vorschlagen. Die hierfür benötigte fachliche Spezialisierung macht solche Alternativen natürlich zunächst zu elitären Projekten. Ohne die bereits angesprochenen neuen Erzählungen und realen Erfahrungen, wie ein zukünftiges Zusammenleben denn funktionieren könnte, gewinnen diese Experteneinschätzungen aber keinen breiten Rückhalt. Und hierfür braucht es sehr unterschiedliche Stimmen, Gemeinschaften und Vorbilder.
Entscheidend ist für alle Beteiligten, dass wir eine bewusste politische Veränderung unserer Bewertungsmaßstäbe anstrengen müssen. Unsere Ökonomien sind derzeit „an sich“ amoralisch, wir brauchen aber, um eine alte deutsche Unterscheidung zu bemühen, eine ökonomische Moral „für sich“, die sich aus den durch uns festgelegten Zwecken, aus den Erfordernissen unser aller Überlebens ableitet – das wird ein Kraftakt!
Sie beschreiben, dass entscheidende Handlungsspielräume und politische Einflussmöglichkeiten an den Nationalstaat gebunden sind. Gleichzeitig sehen wir immer wieder, wie fragil die staatlichen Infrastrukturen sind. Wo liegen also die Gefahren, wenn wir uns auf den Staat verlassen, und wie kann man ihnen begegnen?
JP In den USA haben wir in den letzten Jahrzehnten vor allem gesehen, welches Gefahrenpotenzial ein Staat birgt, wenn er gegenüber den Prozessen der Monopolisierung neutral bleibt. Das Resultat war die massive Anhäufung von politischer und kultureller Einflussnahme durch neue Plattformen wie Facebook oder Twitter, die ausschließlich kulturellen und marktwirtschaftlichen Mechanismen unterliegen und damit staatlicher Informationsinfrastruktur Konkurrenz machen. Zu einem gewissen Grad hat die Trump-Regierung eine Markenkampagne lanciert, die außer Kontrolle geraten ist und aus Versehen den Staat eingenommen hat. Aber das bedeutet natürlich nicht im Umkehrschluss, dass dem „klassischen“ Staat vertraut werden kann. Ich tendiere zu folgender Sichtweise: In unserer transatlantischen liberalen Kultur der letzten Jahrzehnte haben wir Angst, Misstrauen und Verachtung gegenüber dem Staat kultiviert. Angesichts seines Angriffs durch profitorientierte Akteure haben wir jetzt keine andere Möglichkeit, als seine Institutionen neu zu gestalten. Sie können uns nur schützen, wenn wir es ihnen zutrauen.
Beziehen sich diese Gedanken vornehmlich auf die westlichen Demokratien oder haben die starken Institutionen, die wir etwa in China sehen können, mit Ihren Überlegungen etwas gemeinsam?
JP Ich beanspruche in dieser Frage keine Autorität. Es scheint mir so – und das ist überhaupt kein origineller Gedanke – dass die Kommunistische Partei Chinas, die natürlich nicht die chinesische Nation oder die mehr als eine Milliarde umfassende chinesische Bevölkerung abbildet, es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu einer historischen Herausforderung für die liberalen Demokratien zu werden. Dieses Vorhaben wird begünstigt durch eine weitere Herausforderung der Demokratien, nämlich durch den Klimawandel. Durch ihn müssen Regierungen ein anderes politisches Zeitgefühl entwickeln. Maßnahmen müssen in einem Umfang und mit einem Nachdruck umgesetzt werden, der den geologischen Krisen gewachsen ist. Es ist keineswegs klar, dass wir das demokratisch leisten können. Es hat sich bisher noch nicht herausgestellt, dass irgendeine Politik das kann. Aber ein Staat mit viel Macht über schnelle Entwicklungen, wie sie der chinesische Staat seit 25 Jahren hat, ist dafür einmalig gut aufgestellt. Die chinesische Wirtschaft ist in ihrer aktuellen Verfasstheit noch sehr jung und so konstruiert, dass sie diesen Herausforderungen in Zukunft besser gewachsen sein wird. Momentan passiert in China genau das, was ein Staat braucht, um sich für die kommenden Krisen zu wappnen: Investitionen werden im Bereich Infrastruktur und Energie getätigt. Wir wissen, dass der Westen genau das auch tun müsste. Zum Beispiel müssten zwei bis drei Prozent der jährlichen Investments in Fonds umgelenkt werden, durch die man etwa neue Branchen der Energiewirtschaft aufbauen könnte. Solch eine Investitionstätigkeit hält sich in autoritären Staaten jedoch auch nur für eine gewisse Zeitspanne.
„Der Westen müsste so handeln,“ sagen Sie. Klingen hier Zweifel mit, ob der Westen, sprich der demokratische Kapitalismus, solche neuen Handlungsmuster entwickeln kann?
JP Die Demokratien der Nordhalbkugel sind unvollkommen und fehlerhaft. Was sie aber weiterhin von allen anderen Gesellschaftsmodellen unterscheidet, sind ihre Forderungen nach kollektiver Entscheidungsfindung und nach der Gleichberechtigung aller Menschen. In einer Welt, die wir, ob wir wollen oder nicht, fortwährend füreinander gestalten, gilt es weiterhin, genau danach zu streben. Deshalb ist der einzig sinnvolle Weg derzeit, die Demokratien hinsichtlich ihrer Effektivität in Krisen zu reformieren. Wir haben keine andere Wahl, als uns auf das offene Experiment einer demokratischen Lösungsfindung einzulassen.
Die Fragen stellte Jeanne Bindernagel.
Aus dem Englischen von Emma Hughes