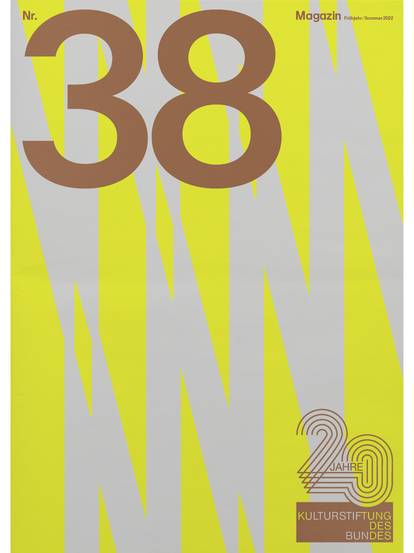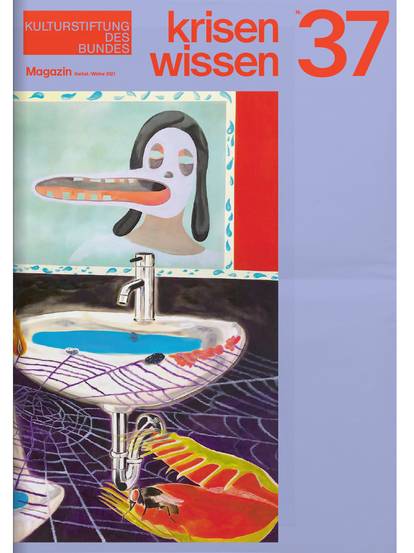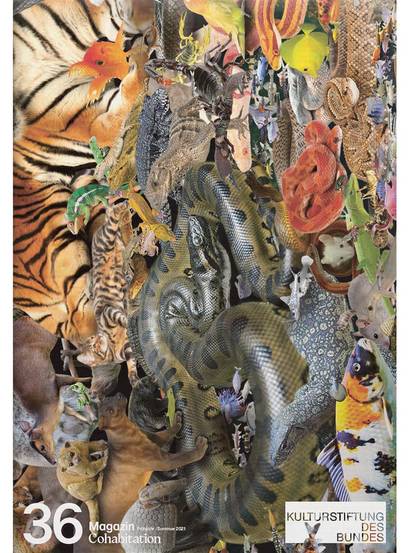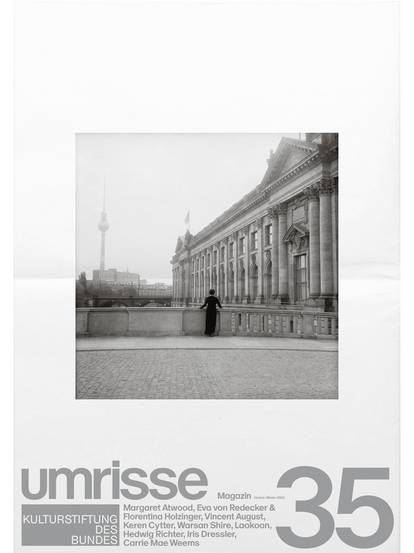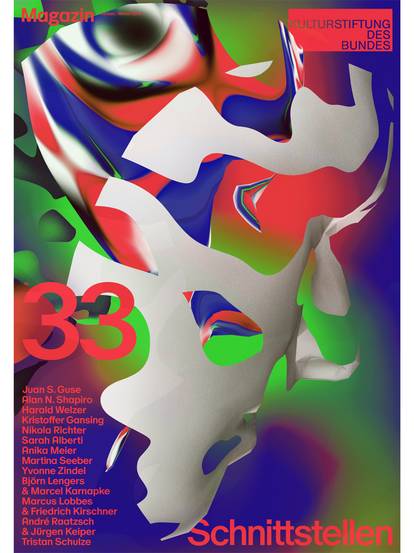Aus persönlicher Erfahrung kann die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Buyx (AB) beschreiben, welche Hemmnisse zwischen Lernerfahrungen in Krisensituationen und der Anpassung gesellschaftlichen Verhaltens bestehen. Im Interview mit dem Politökonomen Robert Lepenies (RL) spricht sie über die Chancen institutioneller Veränderungen im Krisenmodus, verpflichtendes Lernen und die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Beteiligung für das Staatswesen der nächsten Jahre.
RL Liebe Frau Buyx, vor ein paar Tagen hat für diese Ausgabe des Magazins bereits ein Interview mit dem New Yorker Rechts- und Kulturwissenschaftler Jedediah Purdy stattgefunden. Ein wichtiges Gesprächsthema war die Rolle von Angstgefühlen in gesellschaft-lichen Krisensituationen. Welche Rolle spielt Angst, wenn Sie Zukunftsverläufe prognostizieren und daraus Ratschläge für die Bundesregierung ableiten?
AB Es gibt diesen schönen und richtigen Satz: Angst ist ein schlechter Berater. Wenn man wie ich eine Rolle in der Politikberatung übernimmt und sich an die Öffentlichkeit wendet, muss man zunächst einmal die Angst spüren – um authentisch zu bleiben und um die Situation überhaupt verstehen zu können. Diese Krise war und ist eine für mich und für sehr viele nie dagewesene Situation, etwas völlig Außergewöhnliches. Die eigene Angst hat hier die Funktion, auf diesen Ausnahmezustand hinzuweisen. Das muss man spüren können, sonst verliert man Empathie und das Bewusstsein, dass es Gruppen gibt, die aus guten Gründen noch ängstlicher und verletzlicher sind als man selbst.
RL Zu welchen gesellschaftlichen Gruppen und zu welchen Ängsten haben Sie denn einen besonderen Zugang?
AB Ich war im positiven Sinne von vielen Angstkulissen isoliert. Unser Wohnraum war nicht winzig klein. Ich hatte keine Angst – obwohl – ich hatte schon zwischendurch kurz Angst, gebe ich offen zu, dass uns unser ganzes System um die Ohren fliegt. Solche Endzeitgedanken hatte ich auch und ich glaube, das ist als initiale Reaktion auf die ersten Bilder dieser Pandemie völlig normal. Mein persönlicher, sehr realer Angstmoment war unter dem Eindruck der Bilder aus Bergamo zu Beginn der Pandemie. Zu diesem Zeitpunkt gab es eine denkwürdige Telko mit über 900 Teilnehmern aus der Medizinethik, in der bereits begonnen wurde, ein Triageprotokoll vorzubereiten. Das war im März 2020. Und ich erinnere Anfang April, wir hatten das Protokoll mehr oder weniger fertiggestellt, kam die Situation, in der unser Chef der Intensivmedizin der Münchner Uniklinik sinngemäß sagte: „Wir haben noch eine Stufe in unserem Handlungsprotokoll. Und wenn wir die erreichen, dann ist Schicht. Dann können wir nicht mehr alle behandeln.“ München war extrem betroffen. Diesen Moment werde ich wahrscheinlich nie vergessen, denn in den schwierigen Fällen der Triage hätte ich die Kolleginnen und Kollegen mit einem klinischen Ethik-Ad-hoc-Team beraten. Dass es wirklich sein kann, dass das deutsche Gesundheitssystem, dass ein Uniklinikum an die absoluten Kapazitätsgrenzen kommt – das ist schon sehr prägend. Und ich glaube, die meisten von uns hatten und haben im Verlauf der Krise vergleichbare Momente.
RL Wie kann man in solchen Krisenmomenten trotzdem handlungsfähig bleiben? Was hilft hier?
AB Man darf sich in meiner Verantwortung nicht von der Angst übermannen lassen. Die Schwere der Situation nicht läppisch abzutun, sich aber auch vor überhasteten Entscheidungen zu schützen – das ist die Aufgabe. Diese notwendige Balance ist mir sehr bewusst und ich habe ganz früh schon immer wieder gebetsmühlenartig betont: Wir sind alle, alle in einer emotionalen Ausnahmesituation und sprechen überhaupt nicht darüber! Wir machen alle so weiter, als wäre das völlig normal. Wir stellen um auf Zoom, auch wir vom Ethikrat, zack, und dann machen wir einfach an der Oberfläche unbeirrt weiter. In Zukunft würde es uns sicher helfen, Ausnahmesituationen auch als solche zu benennen und bewusst zu durchleben.
In vielen Arbeitskontexten war ich in den letzten Monaten außerdem die einzige Ethikerin in extrem hochrangiger Politikberatung. Der Austausch zwischen Medizin-Ethikern in Europa hat geholfen, dieses Gefühl von unerhörter Unsicherheit zu bewältigen.
RL Glauben Sie, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht mitbekommen hat, wie nahe wir dieser Entscheidung einer Triage mancherorts schon waren? Hatten Sie manchmal das Gefühl‚ wir müssten klarer kommunizieren, wo wir eigentlich wirklich stehen?
AB Gesagt wurde das meiner Einschätzung nach sehr deutlich. Aber verschiedene sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass vor allem die persönliche Betroffenheit den Blick auf die Krise prägt, der direkte Kontakt mit einer erkrankten Person etwa. Natürlich ist man dann auch weniger anfällig für die Narrative von Corona-Leugnern.
Ich glaube, insgesamt gab es tatsächlich viel Angst. Und je mehr der Ernst der Lage durch offizielle Stellungnahmen unterstrichen wird, desto stärker fällt auch die Abwehrreaktion von Leuten aus, die das nicht aushalten und dann als Folge leugnende Narrative suchen. Das feine Maß zwischen ehrlich zugelassenen Emotionen und einer Emotionalisierung muss gefunden werden. Dieses Maß bietet Schutz davor, dass in gesellschaftlichen Debatten Rationalitätsprinzipien außer Kraft gesetzt werden.
RL Wenn Sie auf die letzten Monate zurückblicken – was folgt aus dieser Krise für kommende? Haben sich unser „Krisenwissen“ und damit unsere Handlungsfähigkeit und Krisenresilienz verbessert? Was gilt es zu tun, damit wir besser aufgestellt sind, auch aus Sicht des Ethikrats?
AB Wir müssen aufarbeiten, wir müssen lernen, wir müssen heilen. Aufarbeiten bedeutet zu schauen, wo Dinge gut gelaufen sind – und es sind viele Dinge gut gelaufen. Und dann müssen wir sehen, wo es gerade bezüglich der staatlichen Corona-Politik Fehler und Probleme gab. Den kritischen Diskurs über letztere brauchen wir, gar keine Frage. Aber viel zu wenig wird auf das geblickt, was zivilgesellschaftlich passiert ist. Es ist erstaunlich: Bis heute erlebt man ständig Leute, die irgendwo zu Höchstleistungen auflaufen. Wieder ein eigenes Beispiel: In München hatten wir eine gewisse Vorwarnung durch den allerersten Ausbruch in Deutschland in der Webasto-Zentrale im Januar. Wir haben damals innerhalb von drei Tagen ein Krankenhaus, ein riesiges Uniklinikum mit vielen Instituten, komplett pandemiefest gemacht. Es war beeindruckend zu sehen, wie schnell die Patientenströme umgeleitet wurden, wie – zack, zack – Schutzkleidung und Hygienekonzepte organisiert wurden. Da flogen auch manchmal die E-Mails morgens um vier durch die Gegend. Dass solche schnellen Antworten und Leistungen in unserer Erzählung der Krise nicht stärker vorkommen, finde ich falsch.
RL An welchen Stellen müssen wir denn aufarbeiten, was nicht gut gelaufen ist?
AB Man muss sich angucken, wie die Institutionen zusammengearbeitet haben, wie das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik funktioniert hat. Wir haben festgestellt, dass Verwaltung und Bürokratie riesige Implementationsprobleme haben, dass Entscheidungswege einfach nicht funktionieren. Wir haben Topwissenschaft, wir haben sehr gute Ideen, aber diese auf den Boden zu bringen, war zum Teil erschütternd schwierig. Das komplexe Verhältnis zwischen Digitalisierung und Datenschutz und unsere Kultur des Umgangs mit Daten müssen sich unbedingt verändern. Und die hinkende Digitalisierung der Schulen natürlich auch. Wir haben deutlich gemerkt, wo unsere gesellschaftlichen Sollbruchstellen liegen. Und die müssen angegangen werden durch konsequentes Lernen aus der Krise: Wie können wir das besser machen? Was für Institutionen brauchen wir?
Das ist für mich als Ethikerin ein ethisches Desiderat aus der Krise. Wir brauchen „pandemic preparedness“. Das sage ich, das sagen meine Kolleginnen und Kollegen schon seit Ewigkeiten. Das wussten wir alles im Prinzip schon vor Covid. Ich denke an dieses herrliche Bonmot von Ross Upshur, einem kanadischen Kollegen, über die Ebola-Bekämpfung in Westafrika: „The most powerful lesson learned […] was that we do not learn our lessons“ [dt.: „Die bedeutsamste Lehre ist, dass wir keine Lehren ziehen“], und das ist in der Tat richtig. Aber wenn wir von selbst keine Lehren ziehen, muss das Lernen eben verpflichtend werden. Es muss institutionalisiert werden.
RL Und wie könnte das funktionieren?
AB Durch den Einbau von Lernkaskaden. Es darf nicht passieren, dass Lernerfolge innerhalb von einer Legislaturperiode wieder verschwinden können. Wir haben jetzt ein günstiges Gelegenheitsfenster, um uns neue Strukturen zu schaffen. Das muss man nutzen. Ich finde etwa die Institution eines Bundesgesundheitsamtes, die in der Vergangenheit abgewickelt und jetzt wieder neu diskutiert wurde, einen absoluten „no brainer“. Es ist nun offensichtlich geworden, dass wir sie gebraucht hätten, ebenso wie eine bessere Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das verbindet sich auch mit einer grundsätzlichen Denkaufgabe für uns: wie man Institutionen, die ganz klar für den Frieden gedacht und für einen ruhigen Alltagsmodus aufgestellt sind, in den Krisenmodus versetzt.
RL Sie meinen, wir brauchen einen weitreichenden Umbau der Institutionen für den Ernstfall?
AB Wir müssen klären, ob es zusätzliche Strukturen, eine Art übergreifende Reserve, eine Art Task Force braucht, die dann ganz schnell aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammentritt. Hier stoßen wir aber an Grenzen durch die Kurzfristigkeit und durch das Zyklische der politischen Entscheidungsfindung. Deswegen muss es gelingen, jenseits von Legislaturperioden Institutionen zu stärken, die nicht direkt politisch sind. Die WHO ist ein gutes Beispiel. Wir brauchen aber auch neue internationale, übergreifende Organisationen, die paritätisch finanziert sind und die über gewisse Durchgriffsmöglichkeiten verfügen. Richtig gut wird das nie funktionieren, ich hoffe aber, es wird besser funktionieren. Das ist die Quadratur des Kreises, eine riesige Herausforderung. Doch ich bin insgesamt optimistisch.
RL Sie haben über die Rolle öffentlicher Institutionen gesprochen – was ist Ihre Botschaft an private Akteure und Unternehmen?
AB Auch diese müssen natürlich an der Gestaltung dieser neuen Institutionen mitwirken. Wir haben in Deutschland einige der weltbesten Logistiker, absolute Spitzenunternehmen. Die konnten in der Impfkampagne ihren Sachverstand nicht einbringen und das verstehe ich überhaupt nicht. Natürlich darf man solche staatlichen Prozesse nicht einfach einem Unternehmen überantworten. Stattdessen sollte es Strukturen geben, die es ermöglichen, die Expertise aus der Privatwirtschaft für solche extrem wichtigen Aufgaben gezielt in Anspruch nehmen zu können.
RL Wie schaffen wir es, gesellschaftliche Gräben zu überbrücken? Sie sprachen von der Notwendigkeit des Heilens ...
AB Das ist schwierig, weil Solidarität über lange Zeit, vor allen Dingen, wenn sie nicht ganz freiwillig ist, über indirekte Gegenseitigkeit stabilisiert wird. Und diese Reziprozitätserwartungen in der Gesellschaft, die sich auf Anerkennung und auf finanziellen Ausgleich beziehen, wurden verletzt. Jetzt gerade sind die Jungen sauer. Nachvollziehbar. Aber wir müssen diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt entgegen einer Lagerbildung, die in der Krise entstanden ist, wieder verbessern.
RL Ist diese Lagerbildung auch im Verhältnis zwischen Staat und Bürgern entstanden?
AB Diesbezüglich brauchen wir mehr Dialog und Möglichkeiten bürgerschaftlicher Beteiligung. Dieser seltsame Eindruck, als gäbe es da oben nur den Staat und da unten uns, also die „willfährige Masse der Bürger“, trifft auf unsere sonstigen politischen Verhältnisse nicht zu. Aber kurzfristig gab es ein sehr direktes Durchregieren. Das hat viele nachvollziehbarerweise sehr verstört. Jetzt müssen wir wieder ein stärkeres Verständnis für die eigene Selbstwirksamkeit herstellen. Und auch anerkennen, dass viele absolut konstruktive Initiativen aus der Bevölkerung nicht wirklich eingebunden wurden.
RL Angenommen, Sie hätten alle Ressourcen für Ihre Arbeit, und weiter angenommen, Sie hätten die Zeit anhalten können – was hätten Sie im Ethikrat anders gemacht? Hätten Sie andere Methoden gewählt, andere Themen bearbeitet?
AB Ich habe zwei Versäumnisse, die ich bedauere. Beide waren der realen Kapazität geschuldet. Das eine ist, dass wir uns zunächst nicht spezifischer mit den ethischen Herausforderungen an die junge Generation beschäftigt haben. Dieses Bedauern bezieht sich aber auf ein früheres Stadium der Pandemie. Das Problem hat sich erst über die Zeit akkumuliert. Wir kriegen jetzt erst die großen Studien zu psychischen Erkrankungen, Bildungsausfällen, sozialen Effekten und häuslicher Gewalt. Wir und ich haben im Verlauf der Pandemie versucht, zu den Anliegen der jungen Generation eine öffentliche Debatte anzuregen.
Und das zweite ist das Versäumnis der Partizipation. Das habe ich auch immer wieder angesprochen, aber dennoch ist diesbezüglich aus meiner Sicht vieles vernachlässigt worden. Wie viel man da hätte erproben und implementieren können! Recht früh gab es ja auch z. B. den Hackathon #WirVsVirus, der war super, ein tolles Event. Da waren 70.000 Leute beteiligt. Ich war wirklich schwer beeindruckt. Aber das Erarbeitete dann auch wirklich umzusetzen, dieser Prozess funktioniert in den bestehenden politischen Strukturen nicht so gut. Und da muss man ran: Wie institutionalisiert man das, damit Ideen nicht versanden? Ein anderes Feld der Partizipation betrifft die von Anfang an wirklich gute sozialwissenschaftliche Forschungslage. Auch diese müsste schneller für die politische Entscheidungsfindung verstoffwechselt werden.
Und über die Zeit werden rückblickend sicher noch mehr Versäumnisse erkennbar werden. Es gab und gibt in der Krise so viele ethische Fragen und mit vielen davon haben wir uns wirklich beschäftigt. Aber man kann eben leider nicht alles schaffen.
RL Sind Sie eigentlich froh, in Deutschland Teil des Ethikrats zu sein und nicht zum Beispiel in einem noch stärker polarisierten Kontext wie in Großbritannien?
AB Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Ethiker im Amerika von Trump. Die Kollegen haben keine lustige Zeit gehabt, glaube ich. Und meine Kollegen in England, mit denen ich viel im Austausch bin und war, sind schon auch frustriert gewesen. Wir haben in Deutschland aber dafür andere Probleme: Wir sehen unsere Erfolge nicht so gut und uns fehlt eine gewisse Pragmatik, ebenso wie Infrastrukturen für Krisen. Aber natürlich ist es so, dass wir eine insgesamt – darf ich mal sagen – vernünftige Politik haben. Und bei uns glaubt ein Großteil der Bevölkerung an den Wert von Wissenschaft und an Rationalitätsstandards. Da war ich schon dankbar, in Deutschland zu sein.
Gleichzeitig gab es Momente, in denen ich echt erschüttert war: bei unserem Vorschlag zur Impfpriorisierung zum Beispiel. Selten habe ich ein Papier erarbeitet, bei dem es nicht nur eine breite argumentative Basis aus ethischer Perspektive gab und diese dann auch noch mit dem übereinstimmte, was epidemiologisch geboten war. Darüber hinaus gab es in der Bevölkerung eine wahnsinnig breite Unterstützung dafür. Über 90 % fanden die Priorisierung zunächst genau so richtig. Und dann geht sie als Entwurf in die Umsetzungsphase und Impfeinladungen werden nach Altersschätzung entsprechend den Vornamen verschickt … Da gab es Momente, in denen ich dachte: Ich kann das nicht glauben.
RL Ich bin immer wieder erstaunt, wie häufig wir in Deutschland – in einer globalen Pandemie – eine Debatte über das Leid anderer über unsere Landesgrenzen hinaus vermeiden: zum Beispiel in Bezug auf unzureichende multilaterale Antworten auf Impfstoffproduktion und -verteilung. Müssen wir nicht viel stärker die „distant others“ in moralischen Abwägungen berücksichtigen? Wo ist der deutsche Kosmopolitismus?
AB Ich habe da eine Antwort für den Kosmopoliten. Ich denke diesbezüglich realethisch. Wir sind ja der Deutsche Ethikrat. Selbstverständlich hat uns in der Priorisierung der Impfreihefolge auch sofort die globale Perspektive der Krise beschäftigt. Ich argumentiere deswegen für zwei Dinge gleichzeitig – und das ist schwierig auszuhalten: Wir müssen diese Pandemie weltweit beenden, sonst ist sie bei uns nicht zu Ende. Das Argument einer globalen Solidarität, der Hinweis auf das Leid in anderen Ländern, sollte eigentlich schon für sich genügen. Aber wenn man das nicht als Motivation anerkennt, dann sollte man wenigstens im Eigeninteresse verstehen, dass die Mutationen, die andernorts entstehen, dann auch zu uns kommen. Das ist also auch eine selbstinteressierte, sehr instrumentelle Solidarität.
Gleichzeitig haben Nationalstaaten und insbesondere Regierungen zunächst einen Schutzauftrag für ihre eigene Bevölkerung. Bei uns ist das verfassungsrechtlich verbrieft. Das ist völlig richtig, aber natürlich entsteht daraus ein Widerspruch zu einer tiefen ethischen Überzeugung vieler: „Wir sind als Menschen alle gleich wichtig.“ Im Staatswesen geht die eigene Bevölkerung ganz klar vor den distant others. Das heißt nicht – und so bringt man das dann zusammen –, dass wir Menschen uns nicht auch über Grenzen hinweg umeinander kümmern müssten. Wenn man die eigene Bevölkerung versorgt hat, dann muss man die anderen mitversorgen.
RL Sie haben schon früh über andere Herausforderungen und potentielle globale Gesundheitskrisen nachgedacht, wie z. B. in Ihren Schriften über multiresistente Keime oder die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit. Nun merken wir – Sie haben es gesagt –, dass wir eigentlich nicht besonders viel lernen. Was wäre Ihnen also besonders wichtig, als jemand, die diesen Weitblick durch Fachexpertise hat? Wie müssen wir weitermachen?
AB Ich bin niemand, die sagt: Uns stehen jetzt Krisen ins Haus, die noch viel schlimmer werden als das hier. Das wäre Katastrophisieren. Die Antibiotikaresistenz ist ein riesiges Problem, aber ich erwarte in den nächsten zwei Jahren keine Situation, die diese hier in irgendeiner Weise überschreitet. Aber ja, so etwas wird wieder passieren, das war nicht die letzte Pandemie. Und wir haben darüber hinaus die Klimakrise. Der Punkt ist: Es sind schon so viele Ideen für einen Umgang damit da. Es gibt in der modernen Pandemiebekämpfung eine dreißig- oder vierzigjährige Literatur zu genauen Abläufen mit Handlungsempfehlungen. Ich hoffe, dass in der Politik und darüber hinaus der Innovationsschub dieser aktuellen Erfahrung genutzt werden wird. Der Druck sollte da sein.