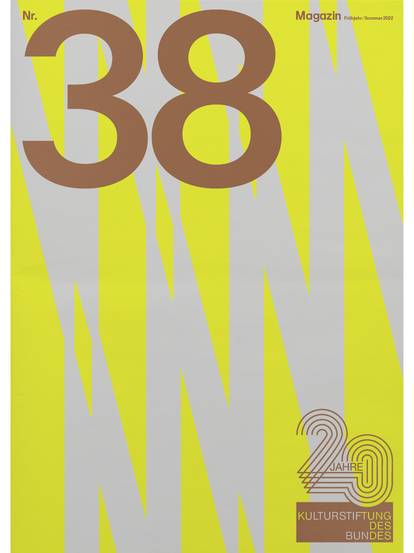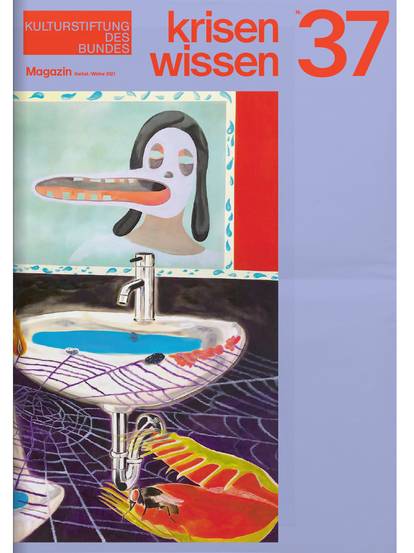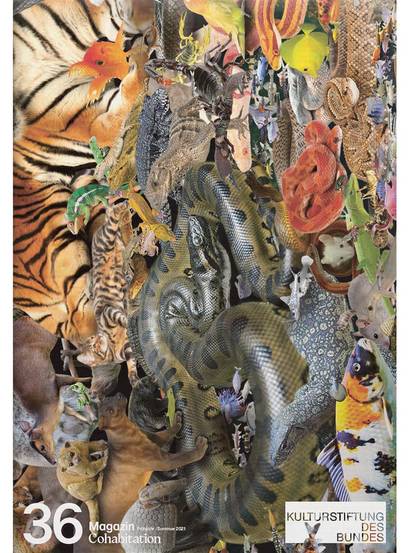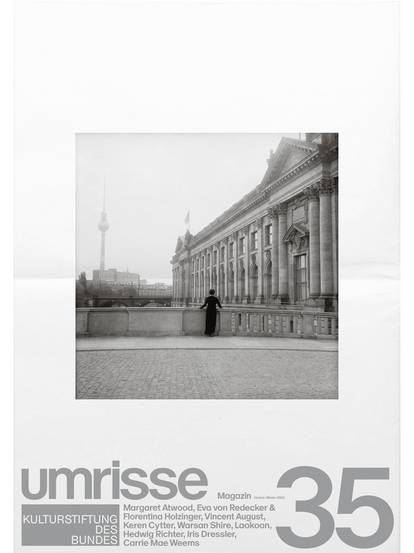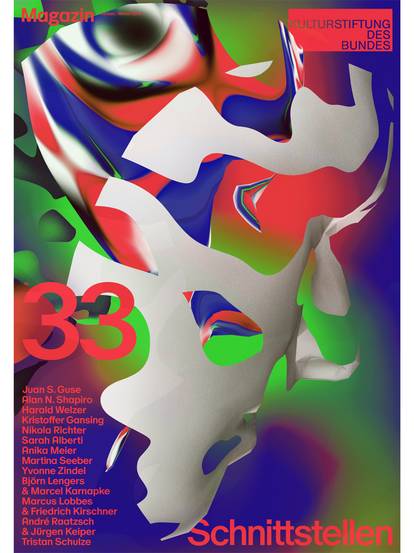Frau Salzmann, Herr Czollek, Sie leben als junge Juden in Deutschland. Viele junge Israelis ziehen gerade nach Berlin. Umgekehrt schreiben z. B. Mirna Funk oder Yascha Mounk Bücher darüber, wie und warum sie Deutschland verlassen. Ist Jüdisch-Sein in Deutschland eine Belastung?
Czollek: Ich fang mal ganz jüdisch mit einem Witz an, den ich Sasha geklaut habe. Frage: Warum nehmen Juden keine Schmerztablette? Antwort: Weil die Schmerzen aufhören könnten! Jüdisch-Sein ist immer eine Belastung. Darum ist es auch kein Problem, in Deutschland zu leben, sondern außerordentlich jüdisch. Dem individuellen Juden stellt sich dann eher die Frage, welche Konflikte er oder sie aushalten will und welche nicht.
Salzmann: In Deutschland können die Menschen nicht mal das Wort „Jude“ aussprechen, ohne das Gesicht zu verziehen, aus Angst, was das alles bedeuten könnte, eine Beschimpfung, eine Opfer-, eine Täter*innengeschichte. Das ist aber für mich keine Belastung, eher für die anderen. Mit meinem Davidstern um den Hals und dem offenen Umgang mit meiner Kultur in Unterhaltungen bin ich oft damit konfrontiert, wie lang der Weg zu einer Normalisierung noch ist. Der ist es aber wert.
Wie unterscheidet sich Ihr Selbstverständnis von dem Ihrer Eltern?
Czollek: Wenn ich mich mit meiner Elterngeneration vergleiche, dann würde ich sagen, dass wir uns nicht so sehr in Perspektive oder Zielsetzung unterscheiden. Vielleicht habe ich weniger von jener Angst, die sich in dem mittlerweile stereotyp gewordenen Bild der gepackten Koffer oder der Schlösser an der Tür ausdrückt. Aber noch etwas anderes spielt eine zentrale Rolle: Ich bin in jüdischen Institutionen sozialisiert worden. Und zwar von der ersten Klasse bis zur dreizehnten in der Jüdischen Schule Berlin und dann noch einmal gegen Ende meines Studiums und für die gesamte Dauer meiner Promotion. Das ist eine Situation, die es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat!
Salzmann: Meine Eltern wurden als Juden entlassen, physisch angegriffen, politisch verfolgt. Sie haben sich für ihre Kinder gewünscht, dass wir nicht mit dieser Realität konfrontiert werden, und versuchten auf ihre Weise einen Spagat zwischen Assimilation und Einpuppung in das Bekannte. Sie haben sich nicht bewusst von anderen Kulturkreisen distanziert, sie haben als Juden unter Juden gelebt, das lag sozusagen in der Natur der Sache damals in der Sowjetunion. Jedenfalls haben sie mir das so erzählt und ich stand dieser Haltung sehr skeptisch gegenüber. Ich habe mir gewünscht, wir wären alle Internationalisten, Kosmopoliten, wir bräuchten keine Markierungen, keine Labels für das, was wir sind, und könnten uns als Menschen begegnen. Da hatte ich noch nicht genug Erfahrung gemacht mit struktureller Exklusion im Alltag, sie war „nur“ erst mal die Erzählung meiner Eltern. Das änderte sich spätestens als ich nach Deutschland kam.
Frau Salzmann, Sie sprechen immer wieder von den shifting personalities, die zeitgenössische Identitäten am treffendsten beschreiben. Gleichzeitig fühlen Sie sich als Jüdin. Ist das eine Konstante in einer sich stetig wandelnden Identität?
Salzmann: Jüdin sein ist das Gegenteil einer Konstante, vielleicht gilt das für alle Identitäten, ich kann nur für meine sprechen. Es gibt ja keine jüdische Kultur, es gibt jüdische Kulturen. Ich bin Atheistin, ich habe keine Verbindung zu Israel, ich bin mit Jiddisch aufgewachsen, vor allem mit den Chochmes und jüdischer Literatur. Shabbes wurde bei uns nicht gefeiert, gleichzeitig gab es Dreidl und Mesusa zu allen möglichen Anlässen geschenkt. Beschneidungen konnten in der Sowjetunion nicht einfach so praktiziert werden, aber Klezmer schallte immer durch die Wohnung. Eine sehr eigene Kreation des Jüdischen, die ich mir da aneignen konnte. Was ich an der jüdischen Kultur liebe, ist, dass sie kein Land hat. Sie entfaltet sich in unterschiedlichsten Gebieten, nimmt Bräuche an und vermischt sich. Das ist ein Teil des Konzeptes um shifting personalities. Letztendlich sind Identitäten ja Transportmittel und keine Zielpunkte. Ich reise auf meiner Jiddischkeit, wohin ich will.
Welche Rolle spielt für Sie, Herr Czollek, Ihre jüdische Herkunft?
Czollek: Ich glaube, dass sich meine „jüdische“ Identität erst begreifen lässt, wenn ich sie im Kontext ihrer Erzeugung sehe. Solange ich auf einer jüdischen Schule war, hat mich die Frage nach dem Judentum ganz anders beschäftigt als danach in einer deutschen Universität, einem mehrheitlich nicht-jüdischen Raum. Ich habe diesen Unterschied zunächst vor allem als einen unterschiedlicher Familiengeschichten erlebt, später dann auch als eine Differenz im Wissen und in der Wahrnehmung: Wer kennt jüdische Festtage? Wer sieht Neubauten und denkt an Bombenlücken? Wer die kleinen GASAG-Bodenplatten mit der Aufschrift „Gas“? Diese Dinge haben nichts mit einem „Jüdisch-Sein“ im Sinne einer jüdischen Essenz zu tun, sondern beziehen sich auf eine bestimmte Umwelt. Darum ist es auch kein Zufall, dass sich mein Selbstverständnis von Sashas unterscheidet. Die Juden gibt es nicht.
Das ID Festival, das im Oktober 2015 zum ersten Mal stattfand und in Deutschland lebende israelische Künstler versammelt, trug den Untertitel „Auf der Suche nach neuen Traditionen deutsch-israelischer Identität“. Wie verhält sich dieser Anspruch zu „Desintegration“, wo es gerade um eine Kritik am neuen „deutsch-jüdischen Wir“ geht?
Czollek: Ich denke, dass in Deutschland beides geht: die Behauptung des Bindestrichs (israelisch-deutsch) und die Kritik an einer zu großen Nähe als Juden für Deutsche. Für jüdische Israelis ist es auch vor dem Hintergrund der politischen Bedeutung, die Deutschland in Israel hat, interessant, die Möglichkeiten einer deutsch-israelischen Identität zu erkunden. Das Konzept der Desintegration wiederum ist vor dem Hintergrund einer Sozialisation als Jude in Deutschland entwickelt worden. Die „Juden“ in Deutschland haben ein merkwürdiges Problem: Sie sind zu wichtig! Nicht nur ist die Vernichtung der Juden zum pars pro toto nationalsozialistischer Verbrechen geworden, diese Erinnerung hat sich auch noch als (bundes-)deutsches Erinnerungs- und Identitätsparadigma durchgesetzt. „Die Juden“ sind zum zentralen Element in einer Konstruktion einer Deutschen nicht-nationalsozialistischen Identität geworden. Als „Jude“ für Deutsche erfülle ich bestimmte Aufgaben wenn ich über Antisemitismus spreche, Position zu Israel beziehe oder über die Shoah/den Holocaust sinniere, indem ich zur Pogromnacht Kerzen anzünde, anlässlich einer Stolpersteinverlegung den Kaddish spreche oder Deutsche in den Arm nehme, weil sie traurig sind über ihren SS-Opa oder die Taten des deutschen Volkes.
Salzmann: Sehen Sie, ich habe ja schon ein Problem mit der Gleichsetzung von Juden und Israelis. Meines Wissens nach leben in Israel nicht nur Juden, aber Juden sind gemeint bei solchen Events, wenn das Bild einer Einigkeit über bestimmte historische Prozesse erzeugt werden soll, der Schuld und Vergebung zum Beispiel, da kann ich nicht mitmachen. Zur deutsch-israelischen Identität kann ich nichts sagen, weil ich nicht mitsprechen kann, was für „neue Traditionen“ diese zwei Länder miteinander entwickeln wollen. Der Desintegrationskongress wird das Harmoniebedürfnis der homogenen Erzählung stören, darauf freue ich mich. Bei dem Kongress geht es mir darum, die Vielfalt zu zeigen, die die Klammer JUDE mit sich bringt, die nicht beachteten Momente, die Überraschungen, die Marginalien. Ich empfinde unseren Kongress auch nicht als Kritik am „deutsch-jüdischen Wir“, ehrlich gesagt, kenne ich ein solches auch nicht.
Bundespräsident Joachim Gauck sagte anlässlich des 50. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, es gebe auch heute keine deutsche Identität ohne Auschwitz und keine israelische Identität ohne die Shoah. Gibt es eine jüdische Identität ohne die Shoah?
Czollek: Sehen Sie, die Shoah bezeichnet doch sehr vieles, auch Popkulturelles. Wenn ich Lyrikworkshops durchführe, mache ich manchmal eine Übung zu Primärassoziationen und sage den Teilnehmenden dann, dass sie diejenigen Begriffe, die am häufigsten genannt werden, für ihre Gedichte nicht verwenden sollen (z.B. für „Liebe“ nicht rot, Herz, Schmerz, usw.). Auch die Shoah löst eine solche Assoziationsketten aus, denken Sie mal an Stacheldraht, ausgehungerte Menschen, Geigen und Viehwaggons. Es geht mir darum, diese Bilder in einem funktionalen Zusammenhang mit einer Erinnerungskultur zu sehen, die von Seiten einer deutschen Dominanzgesellschaft konstruiert wird. Und die hat in Deutschland nun einmal das Problem, ihre eigenen Tätererinnerungen und -positionen verarbeiten zu müssen. Denn die Shoah ist auch Trägerin einer Vielzahl privater Assoziationen, die wahrscheinlich erheblich variieren. Mit der Desintegration soll der Blick geklärt werden für die vielfältigen Bezugnahmen, die möglich sind. Wenn ich es zuspitze, dann geht es mir darum, eine Sprache für die eigene Geschichte zu finden, die nicht nur in Reaktion auf das Begehren von Täternachkommen und ihrem Ringen um ein positives Selbstbild entsteht.
Salzmann: Ich bin die Hälfte meines Lebens aufgewachsen in einer Gesellschaft, die die jüdische Identität ohne die Shoah verhandelt hat. Klingt absurd, denn „Sieger des Krieges gegen den Faschismus“ zu sein, müsste ja eigentlich die Shoah mit inkludieren, tatsächlich war aber das, was den Juden angetan wurde, nicht wichtiger als das, was mit den Kommunisten im Holocaust gewesen ist. Es ist eine Perspektivverschiebung, ein anderer Fokus, man sucht sich immer die passenden Opfernarrative, um sie für den Eigenzweck zu instrumentalisieren. Es gibt viele Länder der ehemaligen Sowjetunion, in denen der Holocaust an den Juden mit Unterstützung der jeweiligen Regionsbevölkerung bis heute nicht nur nicht aufgearbeitet ist, sondern gar nicht eingehend im Geschichtsunterricht vorkommt. Ein Wissen um die jüdische Identität gibt es trotzdem, und wie.
In einem taz-Interview (Dezember 2015) erklärte sich Micha Brumlik den Rechtsruck in den jüdischen Gemeinden wie auch in Israel mit dem Zuzug russischer Einwanderer. Zwischen den jüdischen Gemeinden und den jungen Israelis in Deutschland gibt es wenig Berührungspunkte. Verläuft da eine Kluft entlang der alten Trennlinie Ost/West, oder ist das vielmehr ein Generationenkonflikt?
Salzmann: Ich finde es schwer bis unmöglich, Brumliks Aussage auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unsere Ambivalenzen gegenüber den heutigen Positionierungen der jüdischen Communitys haben sicherlich eine historische Kontinuität, aber man muss sich auch die veränderten Vorzeichen anschauen: Israel ist heute etwas anderes als zur Staatsgründung, und die russischen Juden, die aus ihrem Land fliehen, kommen mit einer anderen Haltung als damals '48. So wie es kein monolithisches Gesellschaftsbild geben kann, kann es auch kein einheitliches Bild einer Community geben. Denken Sie einmal an das Verhältnis zwischen deutschen und osteuropäischen Juden vor der Shoah, ein gegenseitiges kritisches Begutachten, ein Abschätzen. Dabei wurden Hierarchien aufgebaut, die bis heute nachwirken: die armen Jiden aus den Stetle und die großbürgerlichen Juden aus Westeuropa. Andersrum gibt es bis heute einen unterschwelligen bis offen ausgesprochenen Vorwurf der israelischen und russischen Juden an deutsche und osteuropäische Juden, warum sie überlebt haben und auf welche Weise – wer mit wem kooperiert hat, um es durch den Krieg zu schaffen, wer welche Listen erstellt hat und wer im Widerstand und Partisan*in war. Das sind alles Wunden, über die wir nicht gerne sprechen. Aber ich würde unterstreichen: Es sind nicht einfach die russischen Juden versus Israelis oder deutsche Juden, es sind wir alle, die uns einspannen lassen in die divide et impera-Politik eines hegemonialen Diskurses.
Czollek: Ja, ich kann Sasha nur zustimmen und möchte noch hinzufügen, dass die narrativen und anderen Ressourcen, welche durch die beiden großen Einwanderungsbewegungen aus der ehemaligen Sowjetunion und Israel eingebracht worden sind, in der öffentlichen Positionierung jüdischer Gemeinden/Gemeinschaft in Deutschland noch gar nicht richtig aufgenommen oder eingebunden worden sind. Wenn eine sowjetisch-jüdische Perspektive sagt: Wir haben den Krieg gewonnen, dann ist das sehr interessant, weil Juden, die so etwas von sich sagen, sich plötzlich nicht mehr als Opfer positionieren, sondern als Sieger. Wenn Israelis eine deutsch-israelische Kultur aufbauen wollen, dann sind sie plötzlich nicht mehr die Opfer-Juden, die mit schlechtem Gewissen geblieben sind, sondern die, die sich auf Deutschland zubewegen. Jüdische Sieger, jüdische Rächer, Inglourious Basterds – diese Figuren sind von immensem Interesse für ein queering des deutschen Gedächtnistheaters!
Bei „Desintegration“ geht es ausdrücklich auch um das Verbünden mit anderen marginalisierten Gruppen wie z. B. den Muslimen. Spielt die Erfahrung der Marginalisierung für die Identität junger Juden in Deutschland eine größere Rolle als z. B. Religion oder Kultur?
Salzmann: Marginalisierung kann ein Teil einer Kultur sein kann – nicht, dass ich ihr das wünsche, aber der ständige Umgang mit Exklusion schreibt sich ein in die Performance einer Kultur. Ich denke schon, dass die Erfahrung von Ausgrenzung die betroffenen Gruppen einander näher bringt in der Reflexion über strukturelle Benachteiligung und dem Kampf dagegen. Exklusion kann auf unterschiedlichsten Ebenen stattfinden, das kann ja auch wegen geschlechtlicher Identität sein oder ökonomischer. Der Desintegrationskongress ist eine große Einladung zu neuen Allianzen. Die haben nur bedingt was mit ethnischem Background zu tun, es geht um den Willen, aktiv an Selbstbildern zu arbeiten, sie umzudenken und umzuschreiben.
Czollek: Wie eben erwähnt, gehe ich davon aus, dass die Juden in Deutschland nach 1945 bzw. seit den späten 1970ern eine ganz eigentümliche Position innehaben, ungewöhnlich nah an einer deutschen Identität. Es liegt eine verführerische Attraktivität in der damit verbundenen materiellen und sozialen Anerkennung als Juden für Deutsche. Ich glaube, dass wir uns mit anderen marginalisierten Gruppen darüber austauschen sollten, was für Alternativen es zu einer solchen Kooption gibt und welche Erfahrungen sie in und mit der deutschen Dominanzgesellschaft gemacht haben. Diese Frage nach Verbündeten betrifft zugleich aber nicht nur marginalisierte Gruppen, sondern auch Verbündete aus der Dominanzkultur.
Der Begriff „postmigrantisch“, so haben Sie, Frau Salzmann, es einmal ausgedrückt, beschreibt ein „Dasein in der Marginalisierung, obwohl man längst nicht mehr ‚irgendwoher kommt‘“. Die Schriftstellerin Olga Grjasnowa sagt in einem Interview, dass sie höchstens für die Generation der „jungen, überprivilegierten, weißen Menschen“ sprechen könne. Marginalisiert und privilegiert, schließt sich das nicht mehr aus?
Czollek: Ich würde sogar sagen: Das hat es noch nie! Wir sind immer vielfach verortet: Wir haben ja alle ein (zugewiesenes) Geschlecht, eine Hautfarbe, einen ökonomischen Status, eine Religion, ein Alter und eine Krankenakte. Selbst, wenn ich zufällig einmal in allen diesen Punkten privilegiert sein sollte, dann wird sich das mit ziemlicher Sicherheit wieder ändern, denn ich werde ja älter, ich habe vielleicht einen Unfall oder verliere meinen Job. Grundlage der Desintegration ist eine Anerkennung der Rolle von Vielfalt und Eigenständigkeit für eine funktionierende demokratische Ordnung.
Salzmann: Shifting personalities heißt auch shifting contexts. Ich muss mir meiner Privilegien an einem Wohnort wie der Türkei sicherlich bewusst sein, wenn ich jederzeit mit meinem deutschen Pass raus und rein kann und meine Freunde mit türkischer Staatsbürgerschaft nie raus dürfen. Man darf sich der eigenen Position nie sicher sein, man muss sie immer neu verhandeln und dann selber entscheiden, aus welcher Perspektive man sprechen will, bevor das für einen entschieden wird.
Trotzdem ist es nicht so, dass das Dazugehören zu einer hegemonialen Ordnung etwas ist, was ich für mich beschließen oder ablehnen kann. Marginalisierung ist ein radikaler gesellschaftlicher Mechanismus des Ausschlusses. Ob man marginalisiert ist oder nicht, ist letztlich keine identitäre Frage, sondern eine existenzielle.
Bleibt dies nicht ein Paradoxon – ist die „Thematisierung realer Marginalisierungserfahrungen“, um die es bei „Desintegration“ dann doch auch geht, nicht ebenso eine Konstruktion von Identität innerhalb der deutsch-jüdischen Problematik? Kann man so der Wahrnehmung und Festlegung als Opfer entkommen?
Salzmann: Thematisierung realer Marginalisierungserfahrungen ist notwendiger Bestandteil eines Prozesses von Selbstermächtigung. Das bedeutet noch lange nicht, dass man einen Opferdiskurs aufmacht. Für Menschen, die aktiv von Rassismus, Antisemitismus, Chauvinismus und jeglichen Formen der Menschenverachtung betroffen sind, ist ihre alltägliche Erfahrung keine intellektuelle Konstruktion, die man dechiffrieren kann.
Wir entwickeln und besprechen im Kongress Strategien der Unterwanderung, Bandenbildung, queere Positionen und suchen nach neuen Narrativen. Diese Narrative sollen den gegebenen Status quo nicht ausblenden, sondern progressiv damit umgehen.
Czollek: Natürlich ist der Kongress kontextbezogen in dem Maße, in dem er auf eine gegenwärtige Situation Bezug nimmt und eine Intervention sein möchte. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden, und will das auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass diese Gegenüberstellung richtig ist – entweder wir Juden für uns oder wir Juden für Deutsche! Der Kongress ist eine Übung, jüdisch zu sein, der Suche also nach einer Sprache und einem Vorstellungsraum für eine kritische Selbstbestimmung dessen, was jüdische Identität in Deutschland bedeuten kann. Für so eine Suche ist die Gegenüberstellung von Wir und Ihr absolut notwendig, aber diese Gegenüberstellung ist eine performative Behauptung, die letztlich eine strategische Funktion erfüllt. Es gibt uns nicht, aber wir behaupten einen Gegensatz zur Dominanzkultur und machen sie dadurch als deutsch sichtbar.
Ist die deutsche Erinnerungskultur, die sowohl das Gedenken an die Opfer des Holocaust als auch die Erinnerung an die eigene Täterschaft wachhält, inzwischen kontraproduktiv? Was würden Sie daran gern ändern?
Czollek: Mir geht es nicht so sehr um eine Abschaffung des Bestehenden, als um eine Perspektivierung. Die deutsche Erinnerungskultur bildet den Reflexionsprozess einer Dominanzgesellschaft ab, die sich mit ihrer eigenen Täter*innenposition auseinandersetzt. Das bedeutet nicht, dass „die Opfer“ keine Rolle spielen, ganz im Gegenteil: Sie spielen eine sehr wichtige Rolle im deutschen Gedächtnistheater. Und diese Rolle begrenzt die Möglichkeiten dessen, was ein jüdischer Zugriff auf die eigene Geschichte bedeuten könnte. Was würde ich also ändern? Ich würde die Vielfalt der Erinnerungen und Narrative in einer pluralen jüdischen Gemeinschaft stärker betonen und sie der eingespielten Interaktion bestimmter Juden/jüdischer Institutionen mit einer bestimmten deutschen Erinnerungskultur gegenüberstellen. Fluchtpunkt dieser Gegenüberstellung bleibt die öffentliche Wahrnehmbarkeit einer Vielfalt jüdischer Identitäten in Deutschland.
Salzmann: Ich stehe der deutschen Erinnerungskultur sehr skeptisch gegenüber, weil sie sich für mich oft als Stellvertreterdebatte entpuppt, indem man sie als Schutzargument gegen Versuche hält, über strukturellen Rassismus in Deutschland zu sprechen. Die Rechnung, mit der ich mich immer wieder konfrontiert sehe, ist: Wir können keine Rassisten sein, weil wir den Holocaust an den Juden aufgearbeitet haben. Vereinfacht gesagt. Solche Formen von Instrumentalisierungen sind brutal und zeigen ein Ausblenden von zwei Dingen auf: Einerseits, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist, auf dem unsere gesamte Gesellschaft aufbaut und wovon sie profitiert. Sie würde zusammenbrechen, wenn wir an die Länder, in denen wir an Genoziden beteiligt waren, Reparationszahlungen leisten würden. Und zweitens: Dass man Antisemitismus nicht aufarbeiten kann. Er ist ein Teil des Fundaments der Gemeinschaft, in der wir leben. Ich wünsche mir eine permanente Auseinandersetzung damit. Mit einem it´s all done-Häkchen ist es nicht getan.
Die Fragen stellte Friederike Tappe-Hornbostel