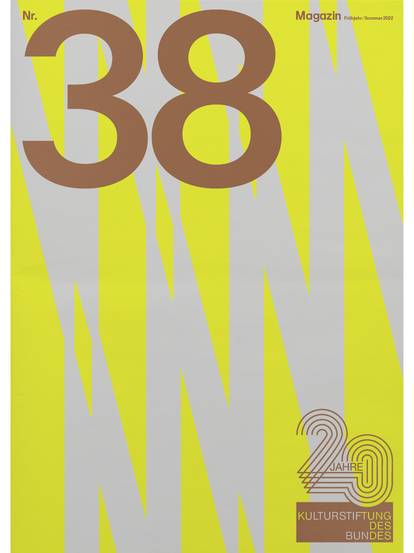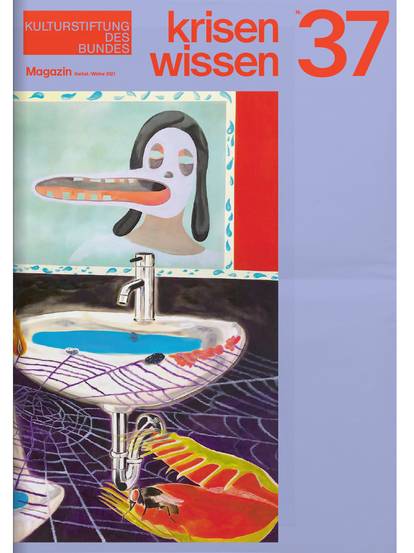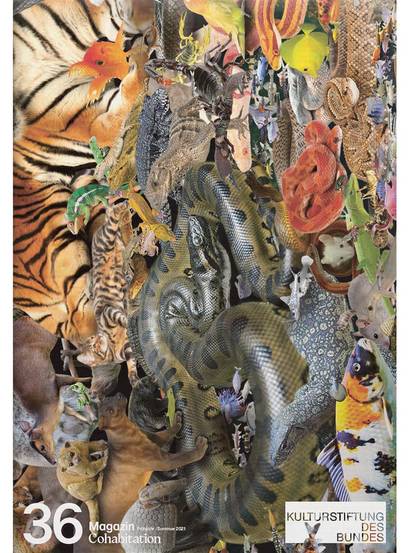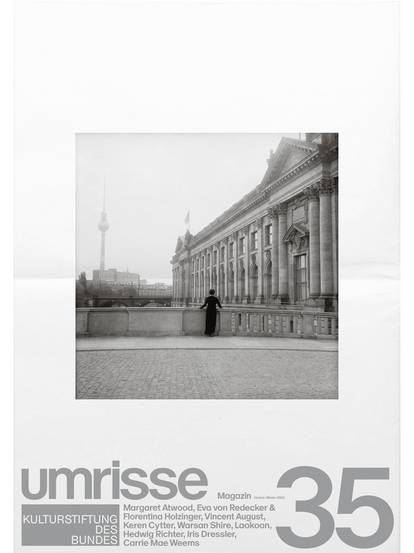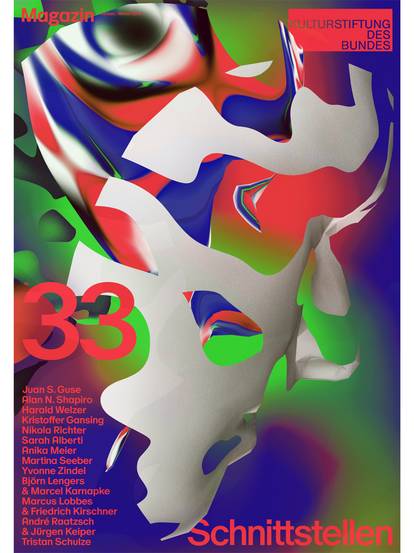Es ist gut zu vergessen. Oder besser: manchmal kann es gut sein. Die Arbeit des Vergessens befreit mitunter von seelischem oder emotionalem Druck, sie eröffnet der Phantasie unbekannten Spielraum und beseitigt die Hindernisse vor neuen und wichtigen Erkenntnissen. Sein Unglück zu vergessen bedeutet Glück. Sein Glück zu vergessen kann auch Glück bedeuten, ein anderes, kleineres zwar, aber dennoch Glück, denn was so in Vergessenheit gerät, ist in Wahrheit das Bewusstsein des Verlusts. Einmal erzählte mir jemand von einer Frau, die die Fähigkeit des Vergessens in Liebesdingen zu bewundernswerter Perfektion getrieben hatte. Immer, wenn sie von jemandem enttäuscht worden war, schrieb sie dessen Namen auf einen Zettel, zerriss diesen und spülte ihn das Klo hinunter. So vergaß sie binnen Sekunden den nunmehr nicht mehr geliebten Mann, für den sie vor kurzem noch aus dem Fenster gesprungen wäre.
Einmal erzählte mir jemand von einem Mann, den man für sehr diskret hielt, weil er die ihm anvertrauten Geheimnisse für sich behielt. In Wahrheit behielt er sie nicht für sich, sondern vergaß sie einfach, weshalb er sie nicht weitersagen konnte.
Oder nehmen wir jene Erzählung von Anatole France, in der sich Pilatus an alle Personen und Momente seines Lebens genau erinnern kann, nur eben nicht an Jesus.
Dann gibt es Arten des Vergessens, die mit der Vermehrung des Wissens im Zusammenhang stehen. In der Wissenschaft bzw. in den verschiedenen Wissenschaftszweigen schreitet das Vergessen mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe Freunde, die es sind und häufig hervorheben, wie schwer es sei, auf engstem Fachgebiet mit neuen Forschungsergebnissen Schritt zu halten. Mitunter sind von ihnen Aussagen folgender Art zu hören: Was gestern noch gültig war, das kann (bzw. muss) man heute schon vergessen. Ich habe den Eindruck - wenn man sich als Außenstehender überhaupt eine Vorstellung davon machen kann -, je mehr die Naturwissenschaften sich verzweigen, desto mehr verlieren sie auch den Kontakt zu ihrer eigenen Geschichte. Das Vergessen wird so nicht nur durch die Masse der immer wieder neuen Ergebnisse vorangetrieben, sondern auch durch die Zersplitterung des Wissens.
Diese Feststellung gilt, so glaube ich, in hohem Maße für die Gehirnforschung, die sich unter anderem mit den physiologischen Prozessen des Gedächtnisses beschäftigt.
Demgegenüber scheint die Philosophie - und auch das ist nur der Eindruck des Außenstehenden - zu sehr von der Besinnung auf sich selbst beherrscht zu sein, was zu einem unlösbaren Dilemma führt. Denn die Geschichte der Philosophie lässt sich nicht so leicht von den Problemen ihrer einzelnen Denker trennen wie in den Naturwissenschaften, wo die Teilgebiete bzw. die darauf tätigen Forscher ihrer eigenen jüngeren und natürlich auch älteren Vergangenheit meist den Rücken zukehren. (Die wissenschaftsgeschichtliche Rekonstruktion siehe etwa Feyerabends menippeische Satire mit Galilei als Hauptheld oder Koestlers märchenhaften Nachtwandler-Roman über einen Bramarbas namens Kopernikus und einen Draufgänger namens Kepler - ist dabei eher von ethischem oder geschichtsphilosophischem Interesse und bietet zudem die Möglichkeit beschaulicher Betrachtung.)
Das Vergessen, das mit der Entwicklung des Wissens einhergeht, muss nicht unbedingt produktiv sein. Parallel zur Geschichte der fortlebenden Erfindungen und Entdeckungen könnte man eine Geschichte der vergessenen Erfindungen und Künste schreiben. Im dritten Band von Johann Beckmanns monumentaler Arbeit über die Geschichte der Erfindungen von 1792 etwa finden sich Hunderte Stoffe, Werkzeuge und Verfahren, die heute, wenn überhaupt, nur noch in Fußnoten existieren, weil sie von den folgenden Generationen nicht übernommen worden sind. Offensichtlich glaubte man, diese Dinge und Kunstgriffe nicht zu brauchen. Wir wiederum können die Notwendigkeit dieser vergessenen Erfindungen heute nicht mehr beurteilen, weil sie uns nicht zur Verfügung stehen. (Von den meisten hatten selbst Polydorus Vergilius und Theophilus Presbyter keinen blassen Schimmer, obwohl sie wirklich alles auf der Welt kannten.)
Jene Reiseschreibmaschine mit Typenhebeln, auf der ich die vorliegenden Zeilen zu Papier bringe (vor dem Computerbildschirm schaltet sich mein Gehirn aus, mir fällt da einfach überhaupt nichts ein), diese späte, gezähmte kleine Schwester der römischen Kriegsgeräte wird wahrscheinlich in zwanzig, dreißig Jahren keiner mehr reparieren können, und mit dem Verschwinden der Schreibmaschine wird auch in Vergessenheit geraten, wie Verlag oder Redaktion von ihrem Klappern nur so widerhallten. In ein, zwei Generationen wird sich keiner mehr daran erinnern, was in der Drucktechnik Mono- oder Linotype bedeuteten. Die so gesetzten Bücher werden sich noch lange in den Antiquariaten finden, die Schriftsätze aber wird man weggeworfen haben. Der Bleisatz wird in Vergessenheit geraten. Ganz langsam wird auch das Schreiben per Hand in Vergessenheit geraten, oder besser, es wird in den Hintergrund gedrängt werden. Was so in Vergessenheit gerät, ist die Kultur der Kalligraphie, die im 19. Jahrhundert
ihre Blütezeit hatte und die Schreibkundigen von den Schreibunkundigen trennte. Die Vulgarisierung der Handschrift - die im Übrigen ein Prozess von Jahrhunderten ist und bei uns mit der sogenannten «Schnurschrift» im Regime unter Horthy begann - wird früher oder später selbst in Vergessenheit geraten, und die Graphologie, die früher organischer Bestandteil des lebendigen Wissens war, wird zur Hilfswissenschaft degradiert werden.
Das Schwarzweißfoto auf Papier, ein vollkommen gewöhnliches und selbstverständliches Requisit meiner Kindheit, wird in gar nicht allzu langer Zeit genauso zum Kuriosum wie seinerzeit die Daguerreotypie. Mit seinem Verschwinden im Museum wird auch in Vergessenheit geraten, wie dieser Faktor die Sichtweise der Menschen ein Jahrhundert lang in bedeutendem Maße prägte und gleichzeitig demokratisierte. Das Foto zeugt dabei von einer Ding- und Architekturkultur, die ohne es in Vergessenheit geraten wäre und die mit ihm verloren gehen wird. (Die digitale Fotografie ist natürlich eine großartige Sache, aber sie steht für die heutige Zeit. Sie kann nicht das zeigen, ausdrücken, bewahren, was das schwarzweiße Papierfoto zeigen, ausdrücken, bewahren konnte.)
Auch der Plattenspieler wird in Vergessenheit geraten und mit ihm die schwarzen gerillten Schallplatten. Die 33er wird langsamer in Vergessenheit geraten als die 78er, aber das spielt keine Rolle. Das Abschreiben von Noten wird in Vergessenheit geraten, der Eilbrief wird in Vergessenheit geraten, das im Umschlag zugestellte Telegramm und die mit der Zustellung verbundenen Minidramen. Der Telegrammzusteller ähnelt gespenstisch dem heutigen Pizzaboten, allein mit dem Unterschied, dass er die Telegramme regelmäßig öffnete und las, um das zu erwartende Trinkgeld zu kalkulieren. Und auch diese Parallele selbst wird in Vergessenheit geraten.
Es wird in Vergessenheit geraten, wie das Leben vor der Verbreitung heutzutage üblicher Dienstleistungen oder Erfindungen ausgesehen hat. Als es zum Beispiel vor fünfzehn oder zwanzig Jahren noch kein Mobiltelefon gab, wie die Menschen da ein Rendezvous verabredeten, ein Missverständnis aufklärten, ihre Lieben an einem unbekannten Ort suchten. Oder nehmen wir die ungarische Redewendung, dass bei einem «der Tantus gefallen ist». Sie ist zwar vorläufig noch gebräuchlich, der Tantus selbst aber, jene Münze, mit der die alten Fernsprechanlagen funktionierten, ist zusammen mit dem sie schmückenden Emblem der Post in Vergessenheit geraten. Es gibt auch bereits eine andere Variante der Redewendung, dass nämlich bei einem «die zwanzig Filler gefallen sind», mit zwanzig Fillern allerdings speiste man nicht die Fernsprechanlage, sondern die Personenwaage auf der Straße. Diese aber ist ebenfalls in Vergessenheit geraten, und genauso die Zwanzigfillermünze mit ihren drei stilisierten Weizenähren.
In Vergessenheit geraten verwüstete Landschaften, abgerissene Gebäude, der Geschmack nicht mehr zubereiteter Speisen. Sprachen geraten in Vergessenheit: erst sterben sie aus, dann vergisst man sie, doch es kann auch umgekehrt geschehen oder Hand in Hand. Man vergisst die Personen, die einem nahe standen, und man vergisst auch, wie nahe sie einem standen. Die Aussage «Ich werde dich nie vergessen!», bedeutet eigentlich, dass ich dich schon vergessen habe, und diesen Verdacht oder diese Erfahrung vergisst man ebenso.
Auch uns selbst vergessen wir. Anders ausgedrückt vergessen wir uns durch uns. Wir vergessen eine Reihe von Episoden unseres Lebens, unsere Taten und unser Leiden. Wir vergessen unsere einstigen Ziele und Prinzipien (wenn wir welche hatten), unsere Charakterzüge (wenn wir sie überhaupt gekannt haben), unsere alten Einsichten und Irrtümer. Wir vergessen mit unserem heutigen Selbst das weniger erfahrene, weniger verbrauchte, vielleicht weniger verdorbene Selbst von einst.
Ich kannte einen Mann, der seiner Frau innerhalb von fünf Jahren dreimal dasselbe Verhältnis zu derselben Geliebten gestand, weil er vergessen hatte, dass er es ihr schon gestanden hatte. Ich kannte einen Mann, der zu bekennen vergaß, dass er ein Spitzel gewesen war, und auch die Tatsache selbst, dass er also ein ehemaliger Spitzel war, vergaß er und erklärte im aufrichtigsten Tonfall, dass er nie ein Spitzel gewesen sei, und er war aufrichtig gekränkt, als man ihn an seine Vergesslichkeit erinnerte.
Ich kannte einen Mann, eine Person des öffentlichen Lebens, der vor großem Publikum feierlich erklärte, dass er noch nie gelogen habe. Zum einen hatte er seine Lügen vergessen, zum anderen hatte er auch vergessen, was der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge ist, und seine Anhänger ermunterte er ebenfalls, diese unbedeutende Distinktion so schnell wie möglich zu vergessen. Meine Frage ist deshalb, was wir denn eigentlich hinsichtlich der verschiedenen Untiefen, Nischen, Sektoren des historischen und kulturellen Gedächtnisses erwarten können? Was wir eigentlich sehen werden, wenn wir uns unserer so genannten gemeinsamen Vergangenheit zuwenden, unserer netten kleinen rosenfingrigen Vergangenheit?
Meine Damen und Herren, ich bin Schriftsteller, Erzähler. Während der letzten anderthalb Jahrzehnte habe ich historische Romane geschrieben, schwer lesbare, ernste, dicke Bücher. Jahrelang habe ich in Bibliotheken und Archiven gesessen, um meinen Helden, dem Stoff und den Verhältnissen verlorener Zeiten näher zu kommen. Ich habe geschichtsphilosophische und andere theoretische Arbeiten gelesen, um in bestimmten Grundfragen klarer sehen zu können. Ich habe Historiker und andere Sachkundige konsultiert, zum einen um Daten und Informationen zu erhalten, zum anderen um herauszufinden, ob ich mit meinen immer schwerwiegenderen Zweifeln über unsere kleine anbetungswürdige Vergangenheit allein bin.
Während des Schreibens habe ich Tagebuch geführt, habe in Essays, Aufsätzen, Rezensionen über auftauchende Fragen und Gedanken Auskunft gegeben, und während ich die Art und Weise des ungarischen historischen Gedächtnisses in den ungarischen Romanen aufmerksam verfolgte, habe ich vielleicht auch ein oder zwei wesentliche Züge der ungarischen literarischen Tradition - unserer netten kleinen Tradition-richtig wahrgenommen.
Meine Damen und Herren, das Ergebnis der angespannten Arbeit dieser anderthalb Jahrzehnte könnte ich kurzerhand so zusammenfassen: Nichts werden wir sehen. Oder vorsichtiger und verschwommener formuliert: fast nichts.
Ich behaupte nicht, dass derjenige, der sich auf eine solche Betrachtung einlässt, von vornherein verrückt, blind oder unwissend ist. Im Gegenteil, schon das bloße Vorhaben kann hinsichtlich der Auffassungsgabe, ja der Tugenden des Betreffenden hoffen lassen. Nur ist das Problem ein anderes: dass nämlich die Erfahrungen des historischen oder kulturellen Gedächtnisses keine gemeinsamen Erfahrungen werden können. Jene stellvertretende Rede, die durch die erste Person Plural, das Wörtchen «wir» gekennzeichnet ist, ist durch und durch eine Lüge. Ich könnte es auch so formulieren: Sie ist das Zauberwort der kollektiven Amnesie. Und nur zum Spaß, in Erinnerung an die beängstigenden Wochen des vergangenen Herbstes, füge ich hinzu, dass sich in Ungarn Amnesie und Amnestie noch nie so grundlegend und brutal gegenübergestanden haben wie jetzt. In Ungarn bedeutet heutzutage Amnesie, dass selbst noch innerhalb derselben politischen Richtung, innerhalb der sich wie Indianerstämme gebärdenden Gruppen jeder etwas anderes sieht und interpretiert, wenn er sich einer Person oder einem Ereignis der Vergangenheit zuwendet. Amnestie hingegen bedeutet -. könnte bedeuten -, was Mihály Babits am Ende des Ersten Weltkriegs so formuliert hat: «Nicht mehr fragen nach der Schuld, lasst uns Blumen pflanzen.» Die Frage nach der Schuld aber ist nach den traumatischen Erfahrungen der letzten hundert Jahre in Ungarn unmöglich geworden, und statt erinnernd einander zu verzeihen, leben wir in einer rachsüchtigen Amnesie, wobei das Wörtchen «wir» hier jeden bedeuten kann.
Dafür, dass wir uns auch über die persönliche Erinnerung hinaus erinnern, müssten wir zuallererst darüber nachdenken, im Namen welcher Gemeinschaft wir eigentlich das Wort ergreifen können bzw. die stellvertretende Rede vermeiden sollten. Es gibt einen Staat, dieser besteht aus seinen Bürgern. Es gibt eine Sprache, diese hat ihre Sprecher. In dieser Sprache existiert eine Unmenge an Stereotypen, leeren Klischees, gesunkenen Kulturgütern, und all dies steht der Erinnerung im Weg.
Versuchen wir zum Beispiel unsere heilige nationale Dichtung, Ferenc Kölcseys Hymne, bei deren grotesker Musik wir geschlossen stillstehen, oder unsere andere heilige nationale Dichtung, Mihály Vörösmártys Mahnruf, bei deren nicht weniger falscher Begleitmusik wir ebenso automatisch stillstehen - versuchen wir also diese beiden großartigen Dichtungen heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, innerhalb der Grenzen der EU zu interpretieren! Ich brauche sicher nicht zu sagen, dass die Entstehungsbedingungen der beiden Gedichte zusammen mit ihrem Kontext schon lange in Vergessenheit geraten sind. Ich werde auch niemanden mit der Aufzählung dieser Bedingungen langweilen. Schauen wir lieber, was diese beiden maßgebenden Dichtungen uns heute, 2007, sagen können. Sagen sie uns überhaupt noch etwas darüber hinaus, dass sie uns jährlich ein paar Mal in Jack-in-the-Boxes, in hochschnellende Schachtelteufel verwandeln?
Ist das «Hier musst in Segen oder Fluch / du leben, sterben hier!» auch heutzutage, wo die Mitglieder bestimmter gesellschaftlicher Schichten ohne jede Schwierigkeit im Ausland studieren und arbeiten können, noch gültig? Und war es gültig, als im Herbst und Winter 1956 Hunderttausende das Land verließen? Und im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, zur Zeit der Auswanderungswelle, war es da gültig? (Und nur in Klammern füge ich hinzu: Wer ist denn der «Ungar», für den der Befehl zu unerschütterlicher Treue gilt und den Petõfifi ein paar Jahre später aufspringen lässt? Und für wen gilt er nicht? Allein darüber nachzudenken ist schon erschreckend. Da ist es doch wesentlich beruhigender, Vörösmártys reimenden Leitartikel selbstvergessen als heilige Schrift zu lesen.)
Und wie soll ich heute, 2007, jene Aussage verstehen, dass Gott über unsere Sünden in Zorn entbrannte? Dass er uns also wegen «unserer» Sünden mit Mongolensturm und Türkenjoch, bzw. dann später entsprechend mit Trianon, der deutschen und sowjetischen Besatzung schlug? Führt das nicht schließlich und endlich zum Konzept der kollektiven Verantwortung? Wird dabei nicht die konkrete Verantwortung der jeweiligen politischen Elite zu sehr auf das Ganze der Gesellschaft ausgedehnt, die natürlich «das Volk» heißen muss? Und kann dieses «Volk» im Geiste dieser kollektiven Verantwortung tatsächlich schon für Vergangenheit und Zukunft, für alle Zeit gebüßt haben?
Wie kann man erwarten, dass es in Ungarn ein wirksames kollektives Gedächtnis gibt, das uns das Wissen um die gemeinsame Vergangenheit bewusst und die Gegenwart lebenswert macht, wenn sich historische Forschung und politische Sprache, welche letztere sich ständig auf die Geschichte beruft, nicht einmal Guten Tag sagen? Wie kann man nüchtern und objektiv an einzelne wichtige Ereignisse der ungarischen Geschichte denken, wenn diese Ereignisse Gegenstand eines Kultes sind? Wie kann man in der Geschichte der letzten zweihundert Jahre den tragischen Zusammenstoß der Idee der nationalen Unabhängigkeit und der Idee der bürgerlichen Entwicklung verfolgen, wenn dieses Wörtchen «national» wie beim Pawlowschen Reflex sofort den aggressiven Nationalismus auf den Plan ruft, das Wort «bürgerlich» wiederum genauso aggressiv und ausschließlich von einer bestimmten politischen Partei besetzt ist? Das kollektive Vergessen schreitet mit überraschender Geschwindigkeit voran. Nicht nur, dass «wir», die Mitglieder einer nicht existierenden Gemeinschaft, die Ereignisse des Jahres 1956 vergessen haben (sie wurden schon während der Konsolidierung unter Kádár unterdrückt und gerieten dabei unbemerkt in Vergessenheit), nein, wir, «wir Ungarn», erinnern uns ja nicht einmal mehr an den Niedergang des Kádárismus, an die seichte Diktatur. Was umso erstaunlicher ist, da wir doch angeblich in ihr gelebt haben und vorläufig weder an Gehirnverkalkung noch an Alzheimer leiden.
Ich als Privatperson kann mich natürlich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, was mir gut tut. Als Schriftsteller kann ich sogar noch vorgeben, ein kollektives Gedächtnis wachzurufen, aus dem ich schöpfe. Aber das ist natürlich nur literarische Fiktion, und wenn sie zusätzlich noch mit einer willkürlichen Struktur des Erzählens einhergeht, dann postmoderne Wurzellosigkeit.
Darüber hinaus habe ich keinen Spielraum, ich stoße an die unsichtbaren und doch harten Mauern des Vergessens. Wenn ich mich vor einer anderen Privatperson darauf berufe, dass die Aufdeckung der jüngsten Vergangenheit kontinuierlich und mit großer Kraftanstrengung voranschreitet, dass zum Beispiel in Zeitung X oder Zeitschrift Y je eine Artikelserie über dieses Thema erschienen ist, dann kann ich todsicher damit rechnen, dass mich der andere Staatsbürger nur scharf und durchdringend ansieht und verlauten lässt: «Sie lesen also Zeitung X und Zeitschrift Y!». Womit er mir den Rücken kehrt und ausspuckt.
So muss man sich heutzutage in Ungarn das Vergessen vorstellen.
Könnte ich mich in meiner Phantasie ein wenig über jene Landschaft erheben, in der mein und «unser» Leben ablaufen, könnte ich meinen Blick auf den breiten Strom der Zeit lenken, müsste ich den ersten Satz dieser Zeilen so ergänzen, dass es gut ist, sich in das Vergessen zu verlieren. Freilich nicht in sein Subjekt als vielmehr in sein Objekt.
Einstweilen aber gilt für mich die Aufforderung des Titels.