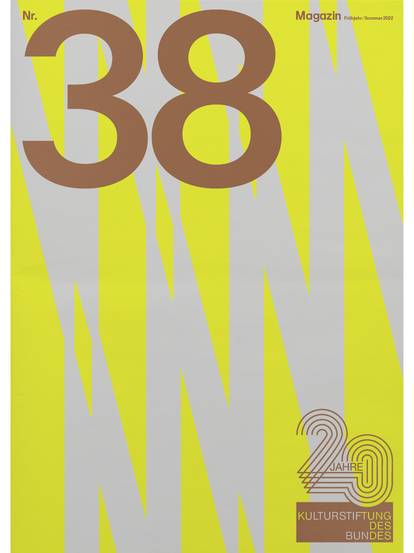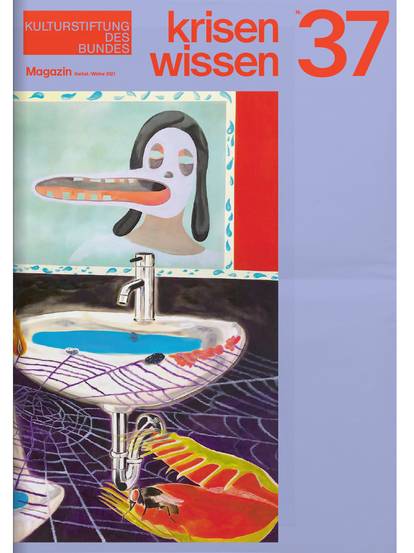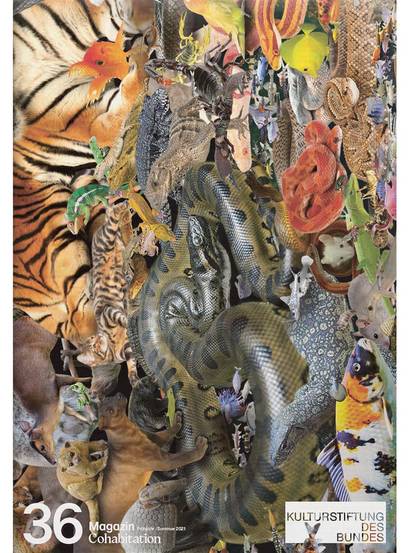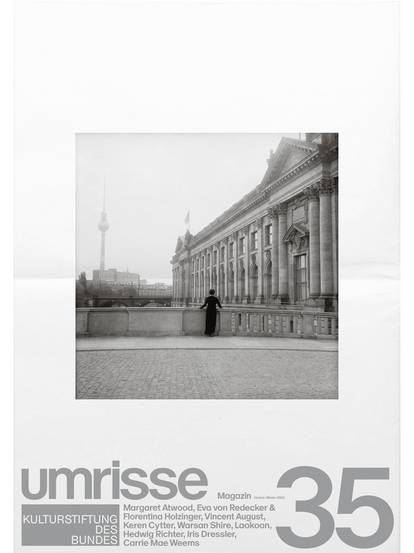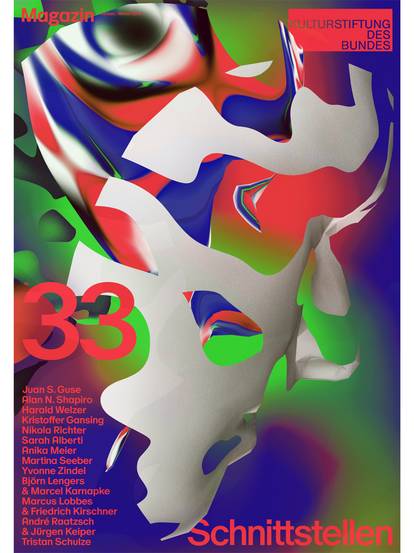Ist die Moderne das Zeitalter von Techniken, die den Tod immer weiter herausschieben, das Zeitalter der Unsichtbarmachung und Entwertung des Todes und zugleich der Aufwertung, ‚Entschlüsselung‘ und Technisierung des Lebens? Wird das Sterben verleugnet – eine bloße Vernichtung von Leben, die man zweckmäßig oder unnötig finden kann – oder wird es nicht doch eher als ‚zum Leben gehörig‘ geradezu eine Sache der Selbstverwirklichung und mittels neuer, moderner Todesbilder romantisiert?
Todesverdrängung, Formlosigkeit des Sterbens, biotechnische Szenarien einer Abschaffung des Todes einerseits, Sterbehilfe, Right do die, massenmediale Inszenierungen von Todesangst, Leichen, Trauer andererseits.
Der Umgang mit dem Sterben scheint widersprüchlich geworden. Eigenartig blass stehen dem alten Namen Tod profane Formen von ‚zu Ende gehendem Leben‘ gegenüber. Dennoch ist das Sterben nicht unbedingt belanglos, sondern auch ungreifbar und unheimlich geworden. Dazu scheinen die Trenngrenzen zu verschwimmen: Ab wann ist jemand oder etwas lebendig? Bringen Lebenstechnologien nicht eigenartige neue Zwischenzustände zwischen Leben und Tod hervor?
Und verschiebt sich nicht auch die Moral? Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass die früher ganz verschiedenen Erfahrungsbereiche des Schwangergehens bzw. Gebärens oder aber des Sterbens in der Bioethik als Grenzfragen von ‚Lebensanfang und Lebensende‘ unter einer gemeinsamen Überschrift zusammenfasst werden. Abwägungen, bis wann sich Leben lohnt und was es wert sei, stehen neben dem Schwur auf die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. So werden die humane embryonale Stammzelle und die Greisin im Wachkoma durch Bioethik zusammengerückt. Sie gelten nicht zum einen als eine bis dato unbekannte Labortatsache und zum anderen als Mensch, dem der Tod sich nähert. Sie erscheinen vielmehr beide gleichermaßen als Grauzonenwesen, als Grenztatbestände von Leben. Die Argumente ähneln sich, mit denen man die zu ‚menschlichem Leben‘ erklärte Zelle und die Sterbende bewertet. Das Untote hat auch in der Ethik Konjunktur.
1. Leben als Geschichtsmacht
Die Form, in der sich Tod und Sterben heute verändern, hat mit dem ‚Leben‘ zu tun, dessen Karriere mit der Moderne beginnt. In dieser Diagnose sind sich die meisten zeitgenössischen Theorien einig. Das Leben als Kollektivsingular für ein überindividuelles Ganzes, dem man eine biologische Beschaffenheit und eine natürliche Dynamik zuschreibt, die durch die Generationen fortreicht, ist ein modernes Konstrukt. Bis etwa 1800 gab es zwar die Lebendigkeit als Eigenschaft, die ein Wesen haben kann. Und es gab die Sterblichkeit als Eigenschaft alles Irdischen wie auch aller Dinge im Kosmos. Man konnte auch vom ‚eigenen Leben‘ oder vom ‚guten Leben‘ sprechen. Dies hieß dann aber, Leben als Erzählzusammenhang oder als Erinnerung zu fassen, als Lebenslauf und gerade nicht als Naturstoff.
Mit der entstehenden Gewebephysiologie und Biologie sowie der Populationsstatistik, Anthropologie und Soziologie formt sich ab 1800 dann die Vorstellung, dass ‚das‘ Leben eine naturwissenschaftliche Größe ist: etwas Empirisches. Eine Sache, die auf Zellebene ebenso angetroffen werden kann wie im Individuum und auf der Ebene ganzer Völker, Gesellschaften oder Arten. Zellen sterben nicht eigentlich, sie teilen sich lediglich und geben das Kontinuum des Lebens weiter. Ähnlich überdauern die Erbeigenschaften den Tod des Exemplars einer Gattung oder Art, sobald das Exemplar sich fortpflanzen konnte. Leben in diesem neuen Sinn – als im Inneren biologischer Prozesse verankert – wird nicht nur zur Grundgröße der modernen Medizin: der Biomedizin und ihren Techniken, von der Epidemiologie und der Immunologie über die Intensivmedizin und Transplantationschirurgie bis zur Gendiagnostik und (angekündigt) der Gentherapie. Ein empirischer Zugriff auf ‚Leben‘ prägt auch die im 19. Jahrhundert entstehende sozialwissenschaftliche Sicht auf die Gesellschaft: von der Sittenstatistik über Sozialversicherung, Sozialhygiene bis zur Eugenik und dem sich zuspitzenden Kampf gegen die Delinquenz.
Die heute so genannten Lebenswissenschaften – life sciences – sind eng mit dem Gedanken des sozialen Nutzens verbunden. Ab 1900 bringt ein Klima von Lebensreform das naturwissenschaftliche Weltbild, sozialtechnische Visionen und Lebensphilosophien der verschiedensten Art zusammen. Die biologische Politik – mit Lebenswertkriterien, ersten Selektionstechniken und medizinischer Sterbehilfe – entsteht. Sie ist präventiv orientiert. Sie hantiert auf verschiedenen Skalen mit der Idee der gestaltbaren ‚Qualität‘ von Leben. Und sie ist nur begrenzt am aktuell zu behandelnden Individuum interessiert. Gilt eine Maßnahme der Verbesserung von Leben, wird vielmehr im Medium der Körper der Einzelnen gleichsam die Population therapiert: der Mensch der Zukunft hergestellt. Leben kann so um des Lebens willen Lebendiges abwerten und ausschließen, ohne dass es überhaupt noch als tötbar gilt, ohne also vom Konzept des Todes noch Gebrauch zu machen.
Michel Foucault zufolge ist es eine Macht zum Leben, welche die Sozialpolitik der Moderne trägt: Politik ist Biopolitik, die Leben macht und Sterben lässt – wobei das Sterben, der Gravität und Würde des Todes beraubt, in den Dienst der Produktion von Leben gestellt werden kann, was zunehmend passiert. In den 1970er und 1980er Jahren war daher vom „Verschwinden“ des Todes die Rede. Elisabeth Kübler-Ross und Ivan Illich haben kritisiert, wie die Medizin das Sterben verdrängt, und Philippe Ariès hat den modernen Tod als einen „ins Gegenteil verkehrten“, formlos gewordenen Tod beschrieben, welcher dem Schweigen anheimfällt. Foucaults Diagnose geht weiter: Der Tod wird nicht nur unsichtbar, er wird vielmehr regelrecht absorbiert, er wird zum Rohstoff des Lebens. Giorgio Agamben sieht nicht nur die Opfer der Vernichtungslager des 20. Jahrhunderts, sondern auch die Patienten moderner Intensivstationen darauf reduziert, nur noch „nacktes“, rechtlich ungeschütztes Leben zu sein. Sterben ist hier Vernichtung oder auch Sterbenlassen von jemandem, der gar nicht mehr als Sterbender erscheint. Stets geht es dabei jedoch nicht eigentlich gegen den Einzelnen, sondern vor allem darum, alles für das Ziel einer Qualität des Lebens des Ganzen zu tun.
2. Technisierung des Todes
Leben als Kontinuum, das sich selbst steigern kann und sich zum Wohle seiner selbst auch steigern sollte: im Ergebnis ein Kontinuum, das sein altes Gegenüber, den Tod, und überhaupt sein eigenes Außen frisst. Wird der Tod unter diesem Vorzeichen zum bloßen Lebensende, so erscheint das einerseits als Entwertung. Alte Rituale verblassen, Todesfurcht verliert ihre Gründe, sie verwandelt sich in Furcht vor den konkreten Umständen des Sterbens – Bettlägerigkeit, Hilflosigkeit, Schmerz. Dazu bleibt vielleicht noch eine bilderlose Angst vor etwas, das keinen Namen mehr hat. So geläufig diese Diagnose sein mag – sie ist unvollständig. Denn es gibt ein zweites Faktum, das ebenfalls kaum bestritten wird. Es ist dasjenige einer Ökonomisierung und Technisierung des Todes. Der Entwertung steht eine Inwertsetzung entgegen. Wählt man eine andere Perspektive als diejenige der verlorenen Anerkennung einer eigenständigen Realität des Todes, so ist das Lebensende sehr wohl etwas wert.
Moderne medizinische Techniken, aber auch Militärtechnik und Bestattungstechnik binden ähnlich wie den lebenden Körper des Menschen auch das Sterben und seine stofflichen Resultate in neue Ökonomien ein. Der lebende Organismus verfügt über Funktionen, die sich mit technischen Mitteln ersetzen, verstärken und verändern lassen. So entfaltet die Intensivmedizin von der künstlichen Ernährung und Beatmung bis zu Reanimationstechniken am Herzen zahlreiche Möglichkeiten, Menschen aus dem Sterben zurückzuholen. Der Organismus enthält aber auch Substanzen, aus denen man etwas machen kann. So wird etwa die Blutspende zu einem wichtigen Baustein der Chirurgie. Auch der tote Körper mobilisiert neue Verwertungsperspektiven. Der Respekt vor der bürgerlichen Totenruhe schwindet. So wird zur hygienischen Entsorgung von Leichen schon vor 1900 die Feuerbestattung üblich. Vor allem aber entwickelt sich der frisch gestorbene Körper zur Rohstoffquelle. Denn die entstehende Transplantationsmedizin benötigt Materialien, die noch möglichst lebendig sind.
Organentnahmen, die den lebenden Menschen töten würden, wären Mord. Darin liegt das Paradox der Transplantationsmedizin: Will sie lebenswichtige Organe verpflanzen, so muss sie Leben aus dem toten Körper gewinnen. Zu warten, bis das Herz eines Sterbenden nicht mehr schlägt, ruiniert die für das Weiterfunktionieren von transplantierten Organen erforderliche Qualität des Materials.
Hat die technische Vision eines Transfers von ‚Leben‘ so besehen kannibalistische Züge? Ist, was dem einen nützt, auf todbringendem Wege entnommen? Nach ersten Transplantationen in der Grauzone löst die Einführung einer neuen Todesdefinition im Jahr 1968 das Problem zugunsten der Organgewinnung auf: Der sogenannte Hirntod legt zerebrale Kriterien für das – strafrechtlich bindende – Lebensende fest. So kann der Tod eines Patienten bereits lange vor dem Herztod diagnostiziert werden: Obwohl das Herz noch schlägt, den Körper durchblutet und vitale Funktionen noch gegeben sind, gilt der Körper als empirisch tot – womit dann der medizinischen Verwertung rechtlich nichts mehr entgegensteht.
Mehr noch als die Intensivmedizin, die Bewusstlose über lange Zeit beatmen und ernähren kann, ist die Zweideutigkeit des Hirntodes zum Exempel dafür geworden, wie die Biomedizin Untote produziert. Der sinnlich erlebte Widerspruch zwischen durchblutetem und auch noch Reflexe zeigenden Körper und der auf abstrakten Messungen beruhenden Erklärung, die ihn als »tot« zur Organentnahme freigibt, taucht die Transplantationsmedizin in ein fahles Licht.
Ist also die Technik die Ursache für verwischende Grenzen zwischen Tod und Leben? Es ist eine Vereinfachung, den Geräten die Schuld zu geben. Der Mythos, die Technik habe den Tod verändert, ist so alt wie die Kritik an der viel beschworenen Lebenserhaltung um jeden Preis, zu welcher die Apparatemedizin angeblich zwingt. Technik am Sterbebett ist vielmehr ebenfalls zweideutig: Sie schafft sowohl die Option einer gewissen Lebensverlängerung wie auch die Option einer Tötung, die – gemessen an früheren Standards – legal nicht möglich war. Die Technik folgt lediglich den vielfachen Interessen am Mehrwert des Lebens. Keineswegs wird die Ressource Leben durch Apparatemedizin blind erhalten, sie wird vielmehr gemessen, bewertet, zugeteilt, umverteilt und rationiert. Medizintechnologien schaffen Möglichkeiten und die technischen Möglichkeiten sind nicht um ihrer selbst willen da. Sie dienen einer differenzierten Ökonomie der Lebensnutzung, in welcher ganz verschiedene Interessen von Patienten, Angehörigen, Betreuern, verschiedenen medizinischen Akteuren, Kostenträgern und auch der Gesundheitsökonomie als Ganze widerstreiten. Das moderne Hinausdehnen des Sterbens ist folglich mehr als bloße Technikfolge. Es zeigt, wie dort, wo Tod war, rund um die stofflichen, zeitlichen und qualitativen Potenziale von Leben ein Markt entstanden ist.
3. Animierte Materie
Nicht nur in der Klinik, auch im Labor geraten lebendig und tot durcheinander. Diese Wahrnehmung hat sich in den letzten Jahren vor allem für den Bereich der Biologie verstärkt, wo mittels sogenannter synthetischer Verfahren lebende Zellen in entscheidenden Komponenten im Labor hergestellt werden können. Offenbar pflanzen sich diese weitgehend technisch hergestellten Formen fort und sind auch sonst überlebensfähig, als seien sie auf natürlichem Wege entstanden.
Die Vision einer Verlebendigung toter Materie wurde schon im 20. Jahrhundert durch Science Fiction-Szenarien stimuliert: Menschliche Gehirne sollten im Computer eine Art ewiges Leben beginnen, winzige Roboter sich im Körperinneren tummeln und durch symbiotische Reparaturarbeiten den Alterstod verhindern. Das Faszinosum, aus totem Stoff könnte Lebendes gemacht werden, reicht noch weiter zurück. Das ‚künstliche‘ Leben gehört zu den Visionen, die den romantischen Beginn der Moderne bebildern: die Beseelung des Automaten, der Homunculus aus dem Glaskolben, das Wesen aus Leichenteilen, das auf elektrischem Wege zum Leben erweckt werden kann.
Der Skandal des künstlichen Lebens unterscheidet sich von demjenigen eines vorgezogenen, unwirklich gewordenen Todes. Animation der Materie – dies hat mit dem Tod erst einmal wenig zu tun. Die Irritation daran, dass Leben womöglich durch biochemische Synthese geschaffen werden kann, stellt weniger das Leben dem Tod als vielmehr das Leben dem Künstlichen gegenüber. In Frage steht nicht ein vom Leben gestaltbares Sterben, sondern die Frage der unnatürlichen Entstehung von Leben – und damit Leitdifferenz von Natur und Künstlichkeit.
Tatsächlich setzt es eine Metaphysik der Natürlichkeit von Leben und die Charakterisierung alles Künstlichen als tot voraus, Artefakte aus dem Labor als „untot“ zu bezeichnen. Auf interessante Weise finden wir den Status von Labortatsachen derzeit mit diametral gegensätzlicher Begründung, aber ähnlichem Ergebnis in der Diskussion. Auf der einen Seite weist die religiös-fundamentalistische Bioethik biotechnische Artefakte als „unnatürliche“ (weil der Schöpfung fremde) Konstrukte zurück. Auf der anderen Seite analysieren Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsgeschichte den hybriden Charakter biotechnischer Laborprodukte, sie seien nicht Artefakte, sondern „Biofakte“, wie die Wissenschaftsphilosophin Nicole Karafyllis es genannt hat: Zwischendinge aus Natur und Kultur – und nicht Leben im herkömmlichen Sinn. So verschieden beide Parteien sind: Jeweils werden hier nicht nur Leben und Natur assoziiert, sondern im Umkehrschluss auch Künstlichkeit, Kultur und unechtes – vulgo ‚untotes‘ – Leben gleichgesetzt. Vom Menschen mit technischen Mitteln und aus unbelebtem Stoff gewonnenes Leben, so die Suggestion, muss falsches, totes Leben sein.
4. Lauter Mitteldinge?
Auch Agambens „nacktes Leben“ trägt Züge eines Hybrids – weniger als Zwischending von Natur und Kunst denn als Mischung aus anerkannter Humanität und bloßer Sache. Die an der Frage des Todes gewonnen Diagnosen zum Siegeszug des Lebens in der Moderne lassen sich also durchaus mit dem suggestiven Bild des Mitteldinges verbinden: einer Deutung der Phänomene am Rande oder jenseits der modernen Grenze des Lebens unter Zuhilfenahme eines Dualismus. Also als Phänomene eines Zwischen-zweien, beispielsweise eines Zwischenreichs zwischen Leben und Tod.
Leben/Tod sowie Natur/Kultur sind allerdings leicht zu verwechseln. Mitteldinge sind einander nicht automatisch gleich. Und namentlich die Natur zaubert sich schnell aus dem metaphysischen Hut. Es ist wahrscheinlich die schwer zu bestimmende Rolle der Technik – des technischen Artefakts, der technischen Intervention –, welche diejenigen, die an den Innovationsdiskursen der Technikentwickler grundsätzlich zweifeln, angesichts des unfassbaren Wandels, der im Zeichen des Lebens zu beobachten ist, zu Dualismen greifen lässt. Und letztlich dann zu Kategorien wie Natur, Schöpfung oder auch einem irgendwie eigentlichen oder echten Leben, das die Züge eines unmanipulierten Naturstoffes trägt.
Stimmt die Diagnose, dass die Moderne von einer Politik der Immanenz des Lebens zehrt, welche dem Tod seine Eigenständigkeit und seine Formen genommen hat, dann ist zu warnen vor einer gewissen Beliebigkeit bei der Verwendung des Attributes tot. Ist im biologischen Sinne unbelebte Materie tot? Ist die Greisin nach festgestelltem Hirntod tot? Ist ein Phänomen an den Rändern dessen, was wir heute Leben nennen, nur deshalb, weil es sich nicht im vollen Wortsinn um Leben handelt, bereits beinahe tot?
Leben kann eine Macht und ein Problem sein, gerade weil es heute keinen Gegenbegriff (mehr) kennt. Analysen eines Biopolitischen setzen hier ein. Der Schock neuer Technologien lädt dennoch dazu ein, wenn schon nicht das ‚echte‘ Leben, so doch die Natur oder anderswie eine außermenschliche Macht als Hilfsgröße zu nutzen, um die Konturen von Biopolitik zu bestimmen: Einer Sterbepolitik, die ins Sterben variable Wertgesichtspunkte einbringt und so Lebenspolitik ist; oder eben einer Biologie, die lebendige Agenzien hervorbringt, die bisher auf der Welt nicht vorkommen, weswegen sie Möglichkeiten eröffnen sollen, aber auch keiner sie kennt.