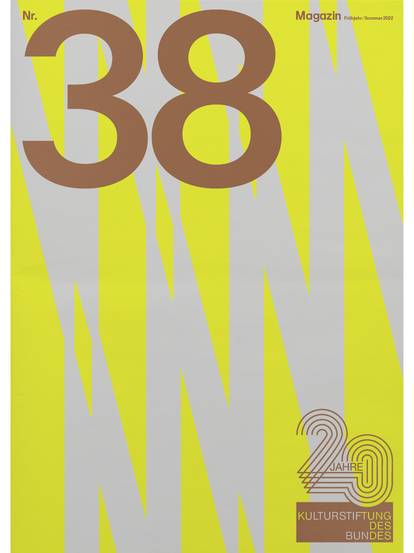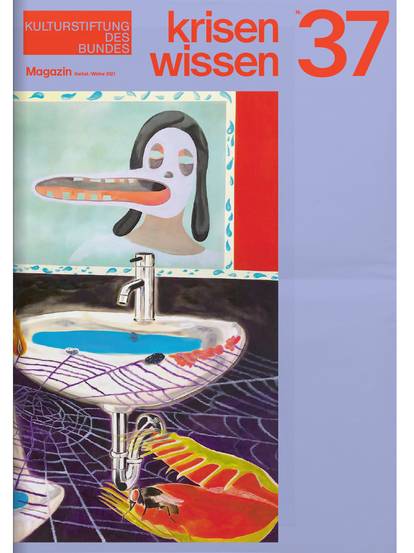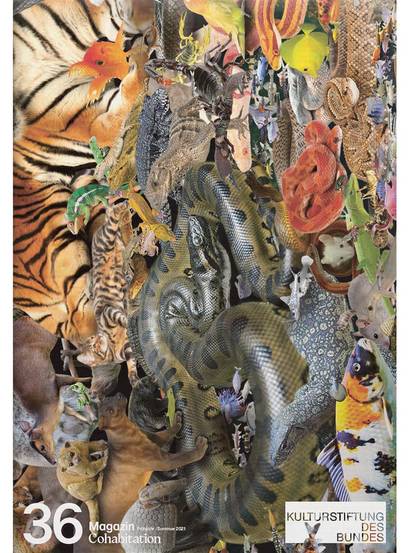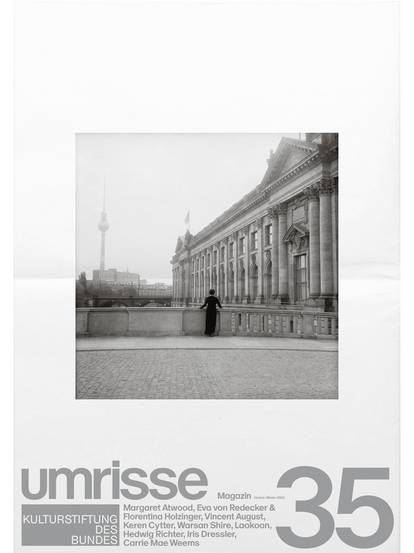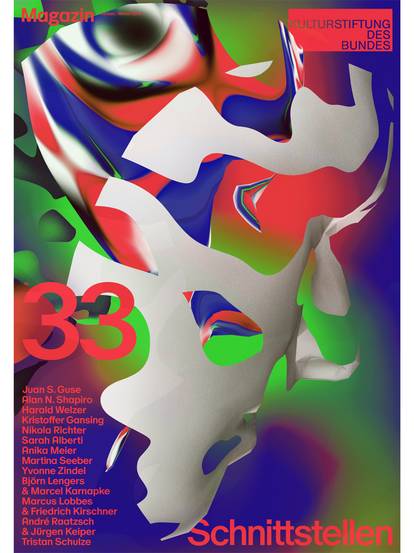Spät in der Nacht mit dem Auto von Saarbrücken nach Mainz, morgens mit den Taxi zum Bahnhof und weiter zum Flughafen; in Calgary unter Plakaten, die vor Nilfieber warnen, durch die Zoll- und Passkontrollen, um die Maschine nach Edmonton zu erwischen und in einem Hotelzimmer zu landen, von dem der Rezeptionist behauptet, Leonard Cohen habe hier seine Sisters of Mercy geschrieben. Dann viel zu früh wieder mit einem Bus zur nächsten Maschine hinauf in die kanadischen North Western Territories, wo die Stewardess eine Lokalzeitung verteilt, aus der die Annonce eines B&B heraussticht, dessen Adresse Norbert und ich schließlich mittags in Yellowknife dem Taxifahrer nennen, worauf dieser murmelt, es sei geschlossen, weil es einem deportierten deutschen Terroristen gehöre, der gerade im Flugzeug nach Deutschland sitze: es ist, als wechselte mit den Zeitzonen auch der Zusammenhang und geriete man von einer Geschichte in die andere, rast- und ortlos, die Reise ohne einen Anfang, die Ankunft noch kein Ende.
Zwei Stunden später saßen wir im Büro der Air Tindi und bekamen samt Preis des Kanus und der Campingausrüstung den Treibstoffverbrauch des Wasserflugzeugs vorgerechnet, das uns am nächsten Tag gegen acht Uhr abends 350 km weiter nördlich absetzen sollte. Wouter Bleeker, der kanadische Geologe, mit dem ich E-Mails austauschte, hatte Wort gehalten und uns die Zielkoordinaten gefaxt, vom bestellten Führer dagegen fehlte jede Nachricht. An seiner Stelle kam, während wir warteten und auf die Wandkarte starrten, auf der Flugdistanzen mit einer roten Schnur abgemessen wurden, ein Inuit an die Tür, Baseballkappe, riesige Brille, Schnauzbart wie ein Walross, die oberen Zähne fast alle ausgefallen, dafür ein Grinsen breit im Gesicht. Er wollte bloß eine Tasse Kaffee, legte aber schließlich seine Parka ab und sah sich mit uns die Route an: Nein, dort wäre er noch nie gewesen, die Gegend kenne er trotzdem gut, ja, er hätte vielleicht Lust, unter Umständen auch Zeit, er heiße Ben. Wer wir seien? Ein Arzt und ein Schriftsteller? Hm…
Das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein, stellte sich erst mit den ersten Schritten zu Fuß ein, die Sonne über dem bis zum Horizont reichenden Great Slave Lake, Yellowknife eine Silhouette aus drei Hochhäusern, die sich als Fassaden eines von Gold- und Diamantminengesellschaften errichteten potemkinschen Dorfes erwiesen: einer Wintersiedlung mit Plattenbauten zwischen Holzhäusern und mit Wellblech gedeckten Tonnendächern inmitten eines Sommers von Felsen, Birken und Wasser, das Zentrum so wenig belebt, dass die Kinder auf dem Asphalt Murmeln spielten. Seinen Namen verdankte der Ort Pelzhändlern, die hier im vorletzten Jahrhundert auf Indianer mit kupfernen Messern getroffen waren, und er hatte sich mit seinen Ausrüstern, Lebensmittelläden und einem gut sortierten Kartengeschäft das Provisorische eines Außenpostens bewahrt.
Auf den in Europa erhältlichen Karten war der Fluss, den wir hinunterpaddeln wollten, nicht eingetragen gewesen; die zwischen großen Binnenseen und dem Eismeer abgebildete Landschaft glich einem Fehldruck, relieflos grau und von einer Moiré aus hellem Blau überzogen. Ihre Legenden – Coppermine River, Prosperous und Trapper Lake – erinnerten an Prospektionszeiten, sie führten das Territorium mit Bezeichnungen wie Redrock Lake, Scented Grass Hills oder Whitewolf bloß generisch vor Augen, um es durch Namen wie Mystery, Desperation und Bliss Lake desto ungreifbarer werden zu lassen. Jetzt aber, die eben erstandenen schwarz-weißen 50.000er und die geologischen Überblickskarten in unserem B&B ausgebreitet, malten wir uns diese abstrakten Flächen von Orange, Rot und Braun als Gegend aus, machten an den Zahlen Meereshöhen und Gefälle aus, je nach Symbol einen Sumpf, Wälder und Stromschnellen, um zu bestimmen, wie weit der Lauf befahrbar war, wo uns das Flugzeug absetzen und wo nach einer Woche wieder abholen könnte. Erst da, auf dem Tisch, konnten wir zum ersten Mal den schwarzen Schriftzug des Acasta River sehen, die Unterlängen zu seinem Ursprung verfolgen und wieder zurück, über Senken und Seenketten bis dorthin, wo sich die Koordinaten zu jener Insel schnitten, die unser Ziel war.
Seit Jahren hatte ich Artikel über die ältesten Gesteinsformationen der Erde gesammelt. Mein Interesse an der Geologie hatte auch mit dem Reisen zu tun: fremder Menschen und Landschaften wegen unternommen, ist es nur die Auseinandersetzung mit beiden, wodurch sie mehr werden als bloße Kulisse. Einen Berg zu besteigen, Eis-, Sand- oder Wasserwüsten zu durchqueren, weil sie da sind, wie Hillary meinte, mag Grund genug sein; doch ohne Wissen dessen, was sie geformt und hat entstehen lassen, bleibt es ein ignorantes Unterfangen und man selbst blind: sie zu überqueren heißt auch, mit jedem Schritt auch Zeiträume durchmessen, eine Erdgeschichte vor Augen, in der ein Hier immer nur vorläufig ist. Vielleicht ist deshalb jede Reise auch vom Verlangen getragen, schließlich an einen Ort zu gelangen, der – weil er stets auf der abgewandten Hälfte der Welt liegt – auch außerhalb von Raum und Zeit zu sein scheint: eine Utopie, gewiss, doch eine solche haben die paradiesischen Vorstellungen eines El Dorado oder Shangri La noch in jedem Jahrhundert verheißen. Geht man diesen Mythen dann jedoch nach, erkennt man, dass jede Sehnsucht letztlich darauf gerichtet ist, sich dem Fremden gegenüber des Eigenen zu versichern, um einen gemeinsamen Ursprung zu entdecken, einen begreifbaren Anfang: der eine Punkt, auf den sich alles zurückführen ließe, auch das eigene Leben. Und es wird daraus eine Suche nach dem, was davon überdauert haben mag: nach der ersten Erde. Von ihr also hatte ich gelesen, ihren Datierungen und Orten: von Isua nordöstlich von Nuuk, am Rande des grönländischen Eisschildes, wo sich das erste Sediment verwitterter Gebirge findet, 3,8 Milliarden Jahre alt; vom Acasta-Gneis im präkambrischen Schild Kanadas; und den auf 4,3 Milliarden Jahre datierten Zirkonen der Narryer Berge Westaustraliens. Während diese Kristalle jedoch nur Zeugnisse einer längst verschwundenen Erdkruste sind, eingelagert in weit jüngerem Trägergestein und bloß noch unter einem Mikroskop sichtbar, ist der Gneis am Acasta als Ganzes erhalten geblieben. Ein Stück davon einmal in Händen zu halten, seine Schwere zu spüren, schien mir so, als könnte man etwas berühren, das unverändert geblieben ist, real im Irrealen der Zeit: den ältesten Stein.
Die Nacht ist kurz; vor soviel Licht, der Luft, die einem zu Kopf steigt, der seltsamen Härte über dem See, der nur ein Ufer zu haben scheint, und dem Schlaflosen der letzten Tage bleibt ein Druck hinter der Stirn, der kurzatmig macht, als befänden wir uns auf 4.000 Metern Höhe. Wir machen die letzten Besorgungen, packen die Ausrüstung zusammen und hinterlassen im B&B die Nachricht, wann wir zurück sein werden. Während die Mechaniker die Twin Otter beladen und das Kanu am Schwimmer festzurren, gehen wir mit dem Piloten die Route durch: er soll uns 20 km nördlich unserer Insel absetzen und später am Little Crapaud Lake weiter südlich abholen.
Von oben erscheint das von langen Gräben zerscherte und von Gletschern flachgeschliffene Schild als langsam abtauchender Kontinent: die nackten Felsbuckel wie Walrücken zwischen ineinander übergehenden, stehenden Gewässern, das Grün der Taiga mit ihren Baumgruppen schorfig dazwischen. Kaum ein Flusslauf ist auszumachen, auch keine Schotterpisten oder Dächer, einmal nur die Landepisten einer aufgegebenen Mine, überall aber in der Sonne aufglänzendes Schmelzwasser, auf dem an manchen Stellen noch eine Eishaut liegt. Je weiter wir dabei in Richtung Polarkreis fliegen, desto dichter werden jedoch die Rauchflächen, über Hunderte Kilometer hergeweht von brennenden Wäldern an der Grenze zu Alaska. Ich vergleiche die Karte mit dem Land und dieses wiederum mit ihr, um den Überblick zu behalten, und als nach mehr als einer Stunde der Little Crapaud Lake vor uns auszumachen ist, packt mich eine seltsame Erregung: das ist der Acasta jetzt, wo er einfließt, dort beginnt unsere Strecke. Der Pilot schwenkt ab, unter uns bleibt das schwarzblaue Band mit seinen Schlingen und Schleifen, das sich an einer Stelle durch einen weiten Sumpf zieht, die weiß gerippten Stromschnellen sehen breit aus, ich sehe die Insel plötzlich mitten im See und deute hinunter, da ist etwas, das metallisch aufgleißt, daneben ein Rot wie von Zelten. Wir gehen nach und nach tiefer, landen, ohne das Aufsetzen zu spüren, und laufen auf die Koniferen einer Strandlinie zu, während sich ein Weißkopfseeadler aufschwingt. Er wäre schon einmal hier gewesen, er hätte Archäologen abgesetzt, sagt der Pilot.
Halte ich den Zeiger auf meinem 24 h-Ziffernblatt zur Sonne, kann ich zu jeder Stunde ablesen, wo die Himmelsrichtungen liegen. Es ist Mitternacht jetzt, ihre Scheibe in diesem Mittsommer knapp über dem Horizont, rot vor Rauch, und bevor wir noch ausgeladen haben, stehen wir schon in Schwärmen von Mücken. Unterhalb unserer Schuttmoräne zieht sich der Sandstreifen zu einer schmalen Furt hin, voll Fährten: Wölfe, Karibus, Elche und ein Bär, behauptet Ben. Was für einer? Grizzly; vor denen aber braucht man keine Angst zu haben – wenn sie sehen, dass wir zu dritt sind, weichen sie aus. Aggressiv werden eher einzelne Schwarzbären: kommt einer, schaut ihm nicht in die Augen und legt euch langsam auf den Bauch, die Hände über dem Nacken. Falls mir aber etwas zustoßen sollte, ist's besser, ihr wisst, wie das Gewehr funktioniert. Er holt eine Pumpgun aus den Bündeln am Strand und erklärt uns den Mechanismus. Sechs Patronen habt ihr, die letzte müsst ihr euch aufsparen, bis er auf fünf Schritte heran ist, dann reißt sie ihm ein kopfgroßes Loch in den Pelz. Er lässt Norbert und mich am Baum vor uns üben, bis zum trockenen Klick des Schlagbolzens, lädt dann aber durch. Wir halten auf den See; in der vollkommenen Stille ist der Schuss so laut, als geriete die Welt aus den Fugen. Und als hätte die Zeit endlich innegehalten, sich verlangsamt auf ein menschlicheres Maß.
Wir sind müde genug, um bei dieser Taghelle zu schlafen. Ein paar Stunden danach weckt uns das Klappern des Kochgeschirrs. Norbert nimmt sich die Rute, wirft sie an der Furt aus und kurbelt; erst scheint es, als wäre bloß der Blinker hängen geblieben, aber es hängt eine armlange Forelle dran. Er nimmt sie ab, wirft nochmals aus und hat eine zweite am Haken, die er aus dem torfbraunen Wasser holt, und beim nächsten Mal auch. Wir grinsen breit übers Gesicht, er ist noch nie angeln gewesen, und jetzt gleich diese Fischergeschichte, die ihm niemand zuhause abnehmen wird. Während Ben sie brät, spazieren wir durch das Buschwerk in eine Senke dahinter. Von den Ausgrabungen, von denen der Pilot erzählt hat, ist nichts zu erkennen; erst später werde ich lesen, dass man dort auf die ältesten Zeugnisse der amerikanischen Urbevölkerung gestoßen ist, die über die Beringstraße einwanderte, auf Kohlenreste von Lagerfeuern und Pfeilspitzen.
Wir beladen das Kanu, stoßen ab und arbeiten uns zunächst am Ufer entlang; wir liegen tief im Wasser, haben kaum mehr als eine Handbreite Freibord, und es dauert, bis wir einen Rhythmus finden und halbwegs Kurs halten. Schwarzfichten ragen vereinzelt zwischen den Felsen auf, ein Geäst dürrer junger Zweige, die der Winter erfriert; an ihrer Grenze geht die Taiga in Tundra über, in ein Unterholz von Weiden, Moos und Sumpf. Auf einer Insel halten wir Rast; gelbe Rentierflechten auf den Gesteinsbrocken, Zwergsträucher, dazwischen kleine weiße Blüten. Vielleicht hat der Fluss seinen Namen von ihnen, der Akaste, jener Tochter des Ozeans, die Apollo nach ihrem Tod in eine Blume verwandelte: Akanthen sind es dennoch keine, sondern Silberwurz.
Die Sonne sticht, es riecht nach Ozon, das Plastik der Schwimmwesten wird heiß; der Wind mitten im See dörrt einen aus, wir trinken immer öfter aus der hohlen Hand, und das Wasser schmeckt süß, ohne dass der Mund dadurch weniger trocken würde. Für die erste Stromschnelle bleiben Ben im Boot und Norbert, dem die Vorstellung einer Wildwasserfahrt nie geheuer gewesen war; doch der See, kaum irgendwo tiefer als zwei Meter, fließt flach in den nächsten über, so dass beide das Kanu über Geröll schieben, ziehen und staken. Ich gehe inzwischen über den Hügelrücken und stoße im Gras auf kreisrunde Rinnen, neben ausgebleichten und überall verstreuten Elchschaufeln; es müssen die Reste eines Zeltlagers sein, doch vor wie vielen Sommern, ist nicht zu sagen. Wir kommen gut voran.
Die nächste Stromschnelle ist nicht auf der Karte verzeichnet, ihr Rauschen aber von Weitem zu hören. Wir gehen sie ab; der Fluss beschreibt hier ein S und wird eng, weiße Wellen über den Wacken bis zu einem Felsklotz, der ihn zweiteilt. Dieses Mal knie ich vorne. Was vom Ufer harmlos aussah, wird im Kanu zu einem Gefälle, in dem es sich kaum steuern lässt. Paddel härter, verdammt! schreit Ben von hinten. Ich steche mit aller Kraft in das Spritzwasser ein und stoße uns vorn von den größten Hindernissen ab, während er gegenrudert. Alles wird schneller, ich kann kaum mithalten, und in der zweiten Biegung laufen wir im Wildwasser an den Fels, bekommen Schieflage, mein Fehler, dass ich mich instinktiv am Bordrand halte, sie vergrößert sich dadurch, von der Seite strömt alles ein, breit und kalt, der erste Packen schwimmt davon, der Bug ist voll Wasser, ich steige aus, auf den Fels, und will das Kanu daran hochziehen. Lass los! brüllt Ben, und ich gebe ihm einen Stoß, stehe nur und schaue, wie er zur Mündung hinuntertreibt, das Kanu bereits unter der Oberfläche, er hilflos darin, bis zum Hals in Wasser, rechts und links unser Gepäck, das abtreibt, fast hat die Szene etwas Komisches, bis alles aus dem Blick gerät. Rechts komme ich nicht ans Ufer, ich finde zu wenig Halt, um mich gegen den Fluss zu stemmen, auf der anderen Seite steht er mir hart bis zur Brust, ich weiß erst nicht, wo hochklettern, und muss dann lange Minuten einen Bogen um das Gestrüpp schlagen, um an ein Ende zu gelangen.
Norbert steht drüben, er deutet irgendwohin, aber ich sehe weder Ben noch das Kanu, nur unsere Ballen sich mit der Strömung verfächernd, von ihr hinaus in die Seemitte geschwemmt. Ich wate zu ihm hinüber; Ben hat das Kanu zwischen zwei Bäumen hochgezogen und umgedreht, wir sind nass bis auf die Knochen und setzen uns erst einmal, um zu Atem zu kommen. Ph! bläst Ben die Backen auf, ich hab geglaubt, mein letztes Stündlein hat geschlagen; ich kann nicht schwimmen… holt sich aus der Brusttasche seine Packung Zigaretten, aber die sind ebenfalls feucht. Norbert macht nicht die geringste gereizte Bemerkung, dafür bin ich ihm dankbar; steht auf, sagt er bloß, wir müssen nach unserem Gepäck sehen. Am Ufer ist nichts zu entdecken. Zwei Paddel haben wir noch, ich halte mich längsseits und tauche den Grund in diesem braunen Wasser ab, ohne etwas zu sehen, bis ich vor Kälte zu zittern beginne und nur zufällig mit dem Fuß an Norberts Rucksack stoße. Wir breiten das Zeug darin zum Trocknen aus: ein Schlafsack, ein Regenschutz, Pullover, Hose, Necessaire. Sonst haben wir nur mehr, was wir am Leib tragen, ich ein All-Weather Field Book, Bleistift und Sackmesser; Ben sein Feuerzeug. Alles Essen, Kochzeug und Gewehr, Kamera, die Zelte, selbst die Angelrute ging verloren, das GPS und auch meine Uhr. Schlimmer ist, dass es keinen Mückenspray mehr gibt; so durchnässt und erschöpft wie wir sind, merken wir nun erst, wie sie uns zusetzen und durch die klammen Kleider stechen. Wir kriegen ein Feuer an und setzen uns eine Zeitlang in den Rauch: entweder Husten oder Kratzen.
Lange halten wir weder das eine noch das andere aus. In dem, was sonst Nacht wäre, paddeln wir wieder los, weil es am Wasser erträglicher ist, suchen erneut alles nach unseren Packen ab, finden jedoch einzig den Sack mit dem Nylonseil für die Portagen und darin wiederum eine von Bens Angelschnüren. Doch dass wir die Karten verloren haben, ist noch schlimmer. Um weiter nach Süden zu gelangen, bleibt uns so einzig, jede Bucht auszufahren, auf der Suche nach dem nächsten Übergang. Wir wechseln uns an den Paddeln ab; Ben fabriziert aus einem bunten Stück Plastik und der Sicherheitsnadel des Nähbriefchens, das Norbert vom Hotel in Edmonton mitgenommen hat, einen Blinker. Der nächsten Stromschnelle entlang tragen wir das Kanu am Rücken, nur um zu merken, dass es von diesem See aus nicht weitergeht, und wieder umzukehren: so wird es uns noch öfter gehen.
Der Wind steht gegen uns, von Südwest oder West, und schmeckt nach Rauch. Ben redet mit den Fischen: Come fishy, fishy! I can taste you, fishy, fishy…You got to be crazy about my hook; come fishy, fishy! Wir fangen nichts; die Wellen laufen quer zum Bug, bis sich einer der Seen verjüngt und zum Flusslauf wird. Wir steigen auf einen Hügel, die höchste Erhebung weit und breit, und schauen: das ist der Mäander des Flusses im Braun und Grün der Marsch, durchbrochen von den Pinselstrichen der Schwarzfichten, eine aus der Entfernung beinah bukolische Landschaft. Später ein versetzt in der Strömung treibendes Schwanenpärchen; jedesmal wenn wir dem Männchen zu nahe kommen, gibt es einen Warnruf ab und flattert ungelenk mit seinen übermäßig großen Flossen und Flügeln auf, um beim Weibchen mit einem Rauschen niederzugehen, wieder und wieder von uns gestört, das Bild einer in dieser Wildnis unmöglichen Schönheit. In der nächsten Flussbiegung plötzlich eine Wolke winziger Fliegen, die auf uns niedergeht, dass ich meinem Vordermann mit der Hand über die Schwimmweste fahre und die Bewegung einen weißen Streifen in ihrem Schwarz hinterlässt.
Abends liegen wir vor dem Feuer, das wir mit den harzig aufflammenden Polstern der Schwarzbeeren füttern. Wir bereiten uns ein Lager aus Weidenzweigen und flechten sie zu einer Barriere, hinter der sich der Rauch sammelt und uns so vor den Mücken bewahrt; der Mond ist aufgegangen und steht ein paar Handbreit neben der Sonne. Ich habe euch eigentlich für typische Cityslickers gehalten, sagt Ben trocken, aber… Nur, was interessieren euch die Steine denn? Sie sind der Anfang von allem, will ich ansetzen und gerate ins Stocken. Neun Milliarden Jahre lang war da, wo wir jetzt liegen, Leere. Es gab zwar Sterne, an Materie jedoch war noch nicht mehr vorhanden als die Rußpartikel, die wir hier den ganzen Tag über riechen. Bis dieser Nebel sich zu verdichten begann, vor viereinhalb Milliarden Jahren. Hätten wir noch eine Orange, sage ich des Beispiels halber, wäre sie die Sonne, die daraus entstand, und die Erde nicht größer als ein Sandkorn in zehn Schritt Entfernung, nein: der eine Funken gerade, dort unten beim Kanu. Mann, du klingst wie die vom Discovery Channel, meint Ben; ich war schon mit Typen vom MIT im Eis, und die waren auf der Suche nach Meteoriten, die so alt sind wie das Sonnensystem, älter also noch als eure Steine morgen. Aber das ist nur Schlacke, werfe ich ein. Als ob Steine was anderes wären. Ja – bloß dass es diese zehn Schritte sind, die sie zur Erde machen: allein in dieser Entfernung bleibt Wasser, ohne das es kein Leben gäbe, auch flüssig. Fische gibt's deswegen aber noch lang keine, entgegnet Ben und lacht; aber red' nur weiter. Ich zähle an den Bedingungen des Lebens auf, was ich noch weiß. Wäre es nicht, noch bevor die Erde eine Kruste hatte, zur Kollision mit einem Planetoiden namens Theia gekommen, die den Mond entstehen ließ, gäbe es weder Tag und Nacht, nur Monate von Licht und Dunkel. Erst dieser Einschlag beschleunigte die Erdrotation so weit, dass die Temperaturen keine extremen Ausmaße erreichten. Der dadurch aus dem Lot geratenen Erdachse verdanken wir auch die Jahreszeiten. Durch den Zusammenprall wuchs zudem die Erdmasse, sodass das Magnetfeld stark genug wurde, um die Sonnenwinde abzulenken, die sonst die Ozonschicht aufgelöst und alles Leben im Keim zerstört hätten. Hätten, hätten, hätten, wirft Ben ein; das denk' ich mir auch, jedesmal, wenn ich hier an den Steinen rumklopfe, weil ich vielleicht eine Goldader finde. Wir starren ins Feuer. Und du, wendet Ben sich an Norbert, glaubst du an Gott? Norbert zuckt mit den Schultern und erwidert schließlich: ob Steine oder Gott, es kommt aufs Gleiche raus; aber was ist mit dir, bist du gläubig? Ben hat nur auf diese Frage gewartet und sieht ihn spöttisch aus den Augenwinkeln an: im Augenblick glaube ich lieber an eure nicht existierende Orange. Vielleicht haben wir morgen Glück und treffen auf eure Geologen, dass die uns etwas abgeben…
Wir waschen uns und sehen, dass wir am ganzen Körper zerstochen sind, münzgroße Blutergüsse selbst noch an den Fußsohlen. Steif vor Muskelkater paddeln wir, am Hang ein wandernder heller Fleck, ein weißer Wolf, der uns begleitet, den Fluss entlang und zum nächsten See. Eine der hereinragenden Landzungen erweist sich endlich als die Spitze jener namenlosen Insel, die wir gesucht haben. Was vom Flugzeug aus metallisch geglänzt hat, ist eine kreisrunde Nissenhütte an einer Bucht, die an einem Hügelbuckel ausläuft. Die Tür ist mit Eisenstäben verbarrikadiert, aber nicht verschlossen; über dem Eingang hängt eine Sperrholzplatte, auf die Wouter Bleeker in großen Lettern ACASTA CITY HALL – FOUNDED 4 GA geschrieben hat. Drinnen finden wir Schaumgummimatratzen, Sessel, Tische, alles, was man nur brauchen kann, um hier den Sommer zu verbringen, sogar einen Grill, dutzende Dosen Mückenspray, gottseidank, aber nichts zu essen, keine Angel, keine Dose, keinen einzigen Keks, vielleicht der Bären wegen. Von den Geologen keine Spur, und was in der Luft nach Zelten aussah, sind leere Kerosinfässer; wir sind allein. Ein Pfad führt den Hügel entlang, wo die Felsflächen mit der Drahtbürste solange von Flechten gesäubert wurden, bis sich die Schichtung darunter zeigt, und weiter durch verkrüppelte Fichten zu einer nackt abfallenden Klippe. Wir klettern im Geröll hinunter zur Wasserlinie und entdecken Bohrlöcher, Lunten und Sprengkapseln: es ist der Felsbruch, dessen Gestein auf 4,03 Milliarden datiert wurde. Die scharfkantigen rauen Splitter und die Brocken, die sich nur zu zweit aufheben lassen, sind grau wie eine mit grobem Bleistift schraffierte Seite, von weißen Einsprengseln durchzogen, manchmal auch schmalen roten Adern und einem Strich tiefschwarzer Kristalle, die unter den Fingern brechen. Der Gneis selbst wirkt so unscheinbar, dass wir kaum einen zweiten Blick darauf geworfen hätten; Bedeutung verleiht ihm einzig, was wir wissen; begreifbar an ihm werden nur Theorien einer ersten Erde. Dennoch will ich aus dem Stein, den ich jetzt beim Schreiben auf dem Tisch hier in der Hand halte, unwillkürlich mit dem Daumennagel etwas herauskratzen, ich kralle fast die Hand um ihn, dass wenigstens der Druck ihn in seiner Wirklichkeit bekräftigt.
Der Hunger gräbt tiefer. Wir paddeln das stehende Gewässer auf der Suche nach einem bisschen Strömung ab, wo sich vielleicht Fische halten, und fangen schließlich einen Weißfisch, den wir nur mit größter Sorgfalt ins Kanu bringen, weil er sich nur allzu leicht vom zurechtgebogenen Haken lösen kann. Auf dem Rückweg zur Insel halten wir an einem vorgelagerten Felsrücken, auch er der ganzen Länge nach von den Geologen geputzt, Stück um Stück freigelegt und mit nummerierten Steinchen versehen, von denen nicht zu sagen ist, was sie bedeuten; aber was zu Tage liegt, sind unzählige Striche, eine Partitur der Erde mit ihren von der Zeit gezogenen Linien, die leer bleiben, bis das Fiepen eines Strandläufers Noten darauf setzt, c, f und g, die im Blau des Himmels nachhallen.
Vor der Hütte spiele ich mit einem der Brocken und versuche, mir diese erste Erde vorzustellen, die weißglühende Fläche, die der See einmal war – zähflüssiges Magma, das unter dem anfänglichen Kometeneinschlag und radioaktiven Strahlungen nur langsam aushärtete, brodelnd Wasser dabei ausscheidend, ohne das kein Gestein entstehen kann, Wasser, das in die glasig erstarrten Klüfte des Basalts dringt, ihn in sich zu verändern, während er auskühlt und zugleich auch der Dampf am Himmel als heißer Regen niedergeht: nach 200 Millionen Jahren bereits gibt es einen Ozean. In ihm sinkt dieser Basalt wieder ab und tief in die Erde, um zu schmelzen, dadurch jedoch erneut hochzusteigen, zu Gneis nun geworden und leicht genug, um eine Insel im Meer zu bilden, an der sich weitere Gneisbögen anlagern, die nach und nach eine Landmasse formen, Hunderte von Kilometern breit. All dies zeigt die oberste Schicht dieses anthrazitfarbenen Steins, sie ist so rau und abgewittert, weil sie offen unter dem Himmel lag, der erste Kontinent, unter einer braun durch schweflige Schwaden schimmernden Sonne, einem Mond, der dunkler, doch größer noch war, weil er der Erde näher lag, in einem Tag, der nur fünf Stunden dämmrige Helligkeit kannte und fünf Stunden Nacht.
Wir nehmen den Fisch aus, sein Magen voll mit der klebrigen Masse verschluckter Insekten, und braten ihn; er schmeckt nach Gras und stillt den Hunger nicht einmal halb. Die Rauchschwaden werden im Abend dichter: entweder ist es der Wind oder der Waldbrand kommt näher. Und je tiefer die Sonne sinkt, desto klarer tritt der Umriss des Hügels hervor, die aufgewölbte Mitte eines Schildes. Die Klippe drüben am anderen Ende dieser Niemandsbucht leuchte rötlich auf, Zeile um Zeile aus den Annalen der Erde, und es ist jetzt erst, dass der griechische Name stimmig wird, für alles, was wandelbar ist, ständig im Fluss: a-casta. Doch die Sprache macht diesen Zeitraum nicht denkbar, sie kann ihn bestenfalls auf die Spanne eines einzigen Tages übertragen, um darin Kontinente und Meere in der ersten, das Leben in der vierten Stunde und uns in den letzten vier Sekunden entstehen zu lassen – doch auch diese vierundzwanzig Stunden verdanken wir dem Mond, seiner nun fahler werdenden Sichel, deren Anziehungskraft die Erddrehung beständig bremste, bis der Tag sich längte zu diesem Kreisen der Sonne jetzt um den See.
Der Stein in meiner Hand war außen noch eine Zeitlang Kometeneinschlägen und innen weiterhin Hitze und Druck ausgesetzt, der Granit und Gabbro in die kleinsten Risse presste, jene Kristalle, hellroten Streifen und milchigen Einsprengsel in seinem monochromen Grau; aber er ragte weiter knapp über einen Ozean, in dem die Chemie des Lebens bereits entstand, nachweisbar in den grönländischen Sedimenten. Das Massiv wurde vor 3 Milliarden Jahren angehoben und zu Gebirgen aufgeworfen, die erodierten und sich am Meeresgrund ablagerten, aber es wuchs weiter und baute sich auf zu einem Urkontinent, der für Äonen bestand, bis Plattenbewegungen einsetzten und ihn schließlich zerrissen. Erst vor 1.8 Milliarden Jahren fügten sich seine Schollen wieder zu einer Landmasse zusammen, vor 1 Milliarde erneut, und vor 200 Millionen ein weiteres Mal – zu jenem Pangaea, von dem sich schließlich unsere Erdteile abspalteten, so dass die Bruchstücke dieser ersten Erde heute in Montana und Wyoming liegen, im Enderby Land der Antarktis, an der chinesisch-koreanischen Grenze, in Goa, rund um die grönländische Hauptstadt Nuuk und über Brasilien und ganz Afrika verstreut.
Es bleibt kaum Zeit, um wenigstens in die Nähe des Lake Crapaud zu gelangen, wo das Flugzeug uns abholen soll. Wir haben stundenlang nach schönen Gesteinsproben gesucht und werfen noch einmal den Haken aus. Zum Abfluss des Sees ist es nicht weit, aber wir haben zu tun, um das Kanu zu schultern und einen Weg entlang der unschiffbaren Stromschnelle zu finden; es geht uns die Kraft aus. Wir paddeln mit Blasen an den Händen, schlafen kaum, und dann unruhig, haben Hunger und erzählen uns Geschichten dagegen, bis uns keine mehr einfallen und wir wieder von vorne beginnen. Am liebsten mag ich die über Bens Vetter, der mit seiner ersten Snowmachine einen Mountie auf seiner Runde zu den Dörfern der Inuit im Norden begleitete. In einem White-Out blieb er in einer Schneewächte stecken, ohne es zu merken, er gab weiter Gas, bis der Polizist im Schlitten dahinter aufstand, zu ihm vorstapfte und dem Fahrer auf die Schulter klopfte, dass der vor Überraschung zusammenzuckte, als stände plötzlich der Teufel neben ihm. In einem ähnlichen White-Out gehen auch die nächsten Tage ineinander über, wir verlieren unser Zeitgefühl ebenso oft wie den Verlauf des Flusses.
Hinter einem großen Sumpfgebiet geraten wir wieder zwischen die Hügel, und bei einer der Portagen schrecken wir einen Schwarzbären aus dem Unterholz. Jetzt kann ich mich bloß noch an seinen großen dunklen Umriss erinnern; wir blickten ihm nicht in die Augen, traten vor ihm zurück und legten uns auf die Erde, dass ich bloß die Sohlen von Norberts Bergschuhen vor mir sah, hörte, wie er näher kam und an ihm herumschnüffelte, laut in der Stille, bis er zu mir trottete. Ich presste die Hände auf den Nacken, aber nicht, wie ich glaubte, weil er mich am Genick packen würde, sondern weil er mit der Schnauze versuchte, jeden von uns auf den Rücken zu drehen, während wir dagegen nur die Beine und Ellbogen auf den Boden stemmen konnten, seinen faulen Geruch in der Nase, seine feuchte Schnauze am Arm, eine Gewalt spürbar, der wir nichts entgegenzusetzen hatten. Das Blut schoss mir in den Bauch, ich vermochte keinen Gedanken zu fassen und war dennoch wach und klar, lebendig wie nie, bis wir nichts mehr hörten und uns vorsichtig aufsetzten, zitternd bis in die Fingerspitzen.
Den Sack mit den Felsbrocken vor mir dann im Kanu, zu müde, um noch müde zu sein, hatte ich mit einem Mal das Gefühl, dass alles zusammengehörte: das Gleißen über dem schweren dunklen Wasser, ein Licht, das von dem allerersten Element ausging, das der Urknall gebildet hatte: dem Wasserstoff, der im Inneren der Sonne zu Helium wird und dabei dieses Licht abstrahlt. Wasser und Licht machen dieses Universum beinahe zur Gänze aus, erst durch sie bildeten sich auch all die übrigen Elemente, um sich schließlich auch zu Gestein zu verfestigen, zu jener Vorstellung von Beständigkeit, an der sich alles Leben misst: in stetem Wandel begriffen wie das Wasser, dessen Moleküle schon vom Anbeginn an da waren, von diesem Licht jedoch immer wieder gespalten wurden, um sich aufs Neue miteinander zu verbinden, verändert sich nichts, nicht wirklich: und all dies ließ sich nun mit einem Mal auch denken, innehaltend im Fluss, innewerdend.
Zum Lake Crapaud gelangten wir nie. An dem Samstag, an dem wir das Flugzeug gegen Mittag erwarteten, waren wir noch an die siebzig Kilometer von ihm entfernt. Wir hatten unsere wenigen Sachen so gut es ging zur Markierung ausgebreitet und horchten auf das Dröhnen der Motoren, versuchten es aus dem Summen der Mücken, dem Brummen der Bienen, Hummeln und Fliegen um unsre Köpfe herauszuhören, hofften, dass es zwischen den Bäumen auftauchte, aber jedesmal war es falscher Alarm und das Warten zermürbender als die Tage vorher. Gegen Abend kam es unvermittelt von hinter dem Hügel, flog knapp über uns hinweg, Norbert schoss die bleistiftgroße Signalrakete ab, die wir in der Hütte der Geologen gefunden hatten, doch das rote Magnesiumlicht hob sich kaum vom Himmel ab und fiel zu schnell in sich zusammen, als dass es die Piloten, deren Profil wir im Cockpit sahen, erkennen konnten. Wir winkten vergeblich, und die Twin Otter verschwand wieder hinter den Wipfeln am anderen Ufer.
Als sie auch nach einer Stunde nicht zurückkehrte, zuckte Ben mit den Schultern. Müssen wir also zu Fuß zurück nach Yellowknife, meinte er stoisch; in wenigen Wochen kommt der Schnee – das heißt, wir brauchen genügend zu essen, Wintersachen und einen Schlafsack: das macht drei Karibufelle für jeden von uns als Kleidung, nochmals sechs, um uns einen Schlafsack zu nähen; sie zu erlegen ist nicht schwer, sie sind kurzsichtig, und die Herden laufen fast blind an einem vorbei; das Fleisch räuchern wir. Was er da sagte, schien völlig normal, den Umständen angemessen, und wäre es vielleicht auch geworden, wenn uns das Flugzeug am nächsten Vormittag nicht doch noch am Fluss gesichtet hätte. Begrüßung gab es kaum eine, die Piloten waren missgestimmt, weil sie nicht wussten, ob sie zu ihrem Geld kommen würden; unsere Gastgeberin hatte sie zu einem weiteren Suchflug gedrängt, sobald ihr klar geworden war, dass wir festsaßen.