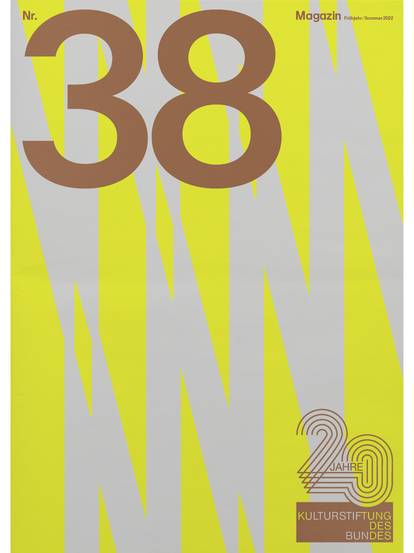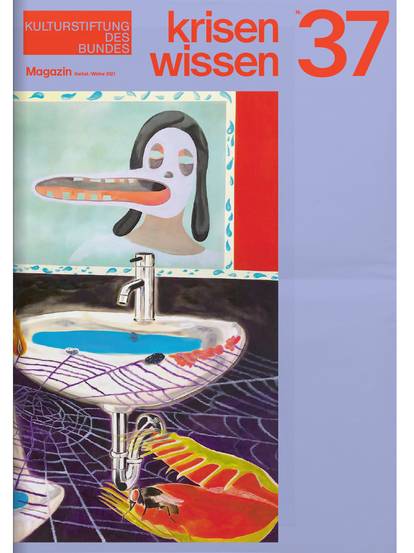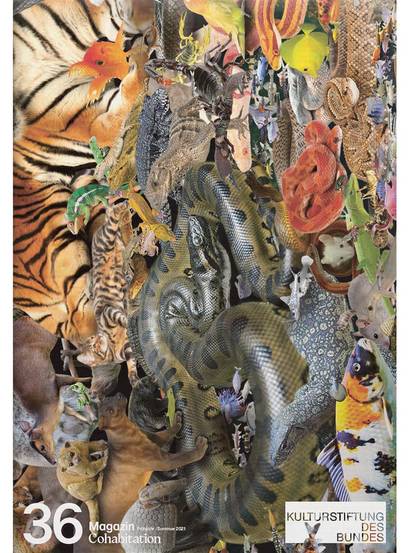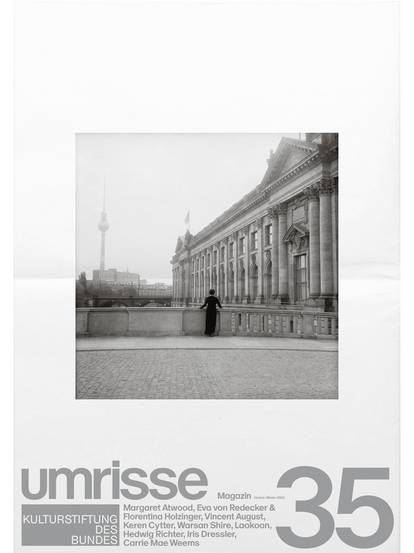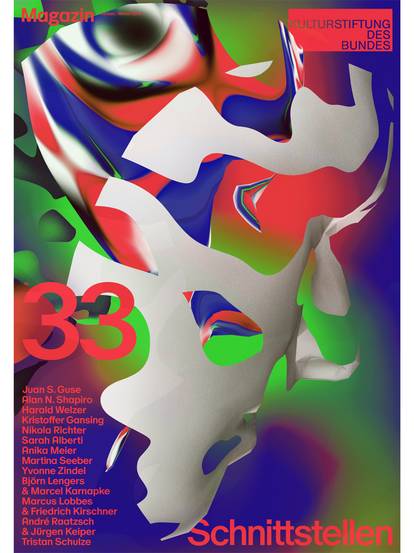Welche Chancen für eine Neuordnung birgt die gegenwärtige Wirtschaftskrise? Wie können wir Wirtschaften anders und besser denken? Was können wir hier von anderen Kulturen und aus der Geschichte lernen? Und wie lassen sich Utopien in die Praxis übersetzen? Mit diesen Fragen haben sich im Sommer Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in einer international und hochkarätig besetzten Veranstaltungsreihe beschäftigt. Einer der Referenten war der Philosoph und Ethiker Thomas Pogge, den wir Ihnen hier vorstellen möchten.
Christian Schlüter: Herr Pogge, wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, von Raubtierkapitalismus und raffgierigen Boni-Bankern zu sprechen. In Folge der sogenannten Banken- und Finanzkrise scheint allen zu dämmern, dass irgendetwas mit der kapitalistischen Marktwirtschaft nicht in Ordnung ist – sie gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch unser aller Freiheit, politisch wie sozial. Sollten wir uns nicht endlich von der Illusion verabschieden, Märkte seien eine moralische Veranstaltung?
Thomas Pogge: Nicht unbedingt. Märkte unterliegen Regeln, und diese Regeln können auf sehr unterschiedliche Art formuliert werden. Sie haben sicherlich Recht, dass unsere gegenwärtigen Marktregeln schlecht funktionieren. Aber das zeigt nicht, dass Märkte mit jedweden Regeln schlecht funktionieren würden. Wir sollten versuchen, Marktregeln zu formulieren, die auch dann eine moralisch akzeptable Verteilung gewährleisten, wenn Marktteilnehmer eigennützig handeln. Ein so regulierter Markt wäre mit einer moralischen Entlastung verbunden: Akteure bräuchten ihre einzelnen (legalen) Marktentscheidungen nicht moralisch zu überdenken, weil auch ohne das ein moralisch gutes Gesamtergebnis erzielt würde.
Schlüter: Schön, das hat Adam Smith als die segensreiche Wirkung der „unsichtbaren Hand des Marktes“ beschrieben: Unabhängig von unserem jeweiligen Verhalten sorgen allein die Prinzipien von Wettbewerb, Angebot und Nachfrage dafür, dass wir als Volkswirtschaft ökonomisch und moralisch erfolgreich sind. Solange wir marktkonform handeln, sind wir immer auf der ‚richtigen‘ Seite …
Pogge: Ja. Nur passiert das eben nicht automatisch, unter beliebigen Marktregeln, sondern nur, wenn ein Markt gerecht und effizient eingerichtet ist. Nur dann gibt es die erwünschte moralische Entlastung. Wenn ich mir beispielsweise Schuhe kaufe, dann möchte ich mir unter den für mich infrage kommenden Modellen das günstigste aussuchen dürfen. Dabei möchte ich die Freiheit haben, wählen zu können, ohne dass ich mich fragen muss, ob diese Paar Schuhe wohl unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt worden ist. Dasselbe gilt, wenn ich eine Arbeit annehme. In all diesen Fällen möchte man darauf vertrauen können, dass der Markt so organisiert ist, dass legale Transaktionen keine schweren Deprivationen produzieren. Das ist gegenwärtig nicht gewährleistet. So werden z.B. für viele Rohstoffe, die wir verbrauchen, korrupte Despoten bezahlt, die mithilfe dieser Zahlungen ihre Landsleute brutal unterdrücken und ihrer Bodenschätze berauben.
Schlüter: Die moralische Entlastung ist also eine wesentliche Funktion des Marktes. Aber führt das im Umkehrschluss nicht zur moralischen Indifferenz?
Pogge: Keineswegs. Es führt dazu, dass wir unsere moralische Aufmerksamkeit auf die Strukturierung des Marktes richten: Man kann Märkte vernünftig oder unvernünftig einrichten, und das liegt allein in unserer Hand. Wir müssen Marktregeln entwickeln, die vernünftige Ergebnisse produzieren. Einen Markt vernünftig zu gestalten heißt, ihn auf möglichst effiziente Weise einen allgemeinwohldienlichen Nutzen haben zu lassen. Denn das ist eine wesentliche Bestimmung des Marktes und macht seine moralische Güte aus.
Schlüter: Das klingt eher wie eine moralische Geldwäsche: Solange die Gesamtbilanz stimmt, brauchen wir uns nicht um die ‚Kollateralschäden‘ zu kümmern, etwa darum, dass wir einem nicht unbeträchtlichen Teil der Menschheit den Marktzugang verweigern.
Pogge: Vom Markt weitgehend ausgeschlossene Menschen sind ein wesentlicher Teil der Gesamtbilanz. Die von reichen Ländern heute aufrechterhaltenen Schutzzölle und Monopole sind nicht nur ineffizient, sondern auch ungerecht – weil sie vorhersehbar vermeidbare Armut produzieren.
Schlüter: Immerhin gibt es mittlerweile zahlreiche Fair-Trade-Initiativen. Mit ihnen soll das Moralische mit dem Ökonomischen verbunden und wohl auch unser Gewissen beruhigt werden.
Pogge: Ich betrachte solche Initiativen eher skeptisch, und zwar gar nicht mal, weil wir durch fairen Handel mit den ärmeren Ländern vorwiegend unser Gewissen beruhigen, sondern weil wir als Käufer oder Konsumenten durch moralische Appelle und Direktiven überfordert werden. Unter den Bedingungen der Globalisierung, also weltumspannender Märkte, kann ich gar nicht absehen, welche weltweiten Folgen mein Wechsel von einer Kaffeemarke zu einer anderen haben wird.
Schlüter: Wir können uns die Überforderung wohl als eine Art permanenten Ausnahmezustand vorstellen. Wir müssten dauernd auf der Hut sein, um bloß nichts falsch zu machen …
Pogge: … Wenn Sie so wollen, ja. Und das hat selbst wieder schlechte Folgen, weil solche Sorgen deprimieren und auch die Kauflaune verderben – wiederum ein ökonomisch nachteiliger Effekt. Außerdem ist das Abstellen auf die individuelle moralische Verantwortung auch sehr fehler- oder irrtumsanfällig …
Schlüter: … moralisch handeln zu wollen, heißt ja nicht, auch tatsächlich moralisch zu handeln.
Pogge: Eben. Moralische Argumente spielen mittlerweile in der Werbung eine große Rolle. Und doch kann man sich nie sicher sein, ob Firmen auch halten, was sie versprechen: Rette ich mit dem Kauf eines Kastens Bier tatsächlich einen Quadratmeter Regenwald? Oder haben wir es hier nicht vor allem mit verkaufsfördernden Maßnahmen zu tun? Mit anderen Worten: Wir sollten die Mikroebene unseres konkreten Verhaltens nicht aus den Augen verlieren, aber nachhaltige Veränderungen werden wir nur auf der Makroebene erreichen.
Schlüter: Na ja, auf der Mikroebene findet zum Beispiel auch so etwas statt wie die Spenden für die Erdbebenopfer in Haiti. Ist das eine schlechte Sache?
Pogge: Moralisch verurteile ich das überhaupt nicht. Ich bezweifele nur, ob das wirklich die effizienteste Weise ist, unserer moralischen Verpflichtung als Marktteilnehmer nachzukommen. Eine Spende ist ein freiwilliger Akt. Wenn wir aber von Armut sprechen, bekommen wir es mit einem ganz anderen Problem zu tun. Unser Verhältnis zu den armen und hilfsbedürftigen Menschen ist gerade nicht so zu verstehen, dass wir ihnen etwas spenden, so wie wir auch dem Bettler am Straßenrand ein paar Münzen in den Hut werfen. Die lebensgefährliche Armut, die heute rund 40 Prozent der Weltbevölkerung bedrückt, stellt in fast allen Fällen eine Verletzung ihrer Menschenrechte dar, eben weil sie vorhersehbarerweise von Regeln produziert wird, die von anderen Menschen formuliert und durchgesetzt werden. Durch solche Regeln werden jährlich 18 Millionen Menschen umgebracht, und Milliarden der Zugang zu hinreichendem Trinkwasser, gesunder Nahrung, Obdach, Kleidung, medizinischer Versorgung und Bildung verwehrt. Die Armen in dieser Welt leben nicht nur in menschenunwürdigen, sondern auch in menschenrechtswidrigen Verhältnissen. Daraus ergibt sich für uns eine unbedingte moralische Pflicht, deren Erfüllung keine in unser Belieben gestellte Freiwilligkeit oder Großzügigkeit darstellt.
Schlüter: Aber gilt diese moralische Pflicht nicht nur unter der Voraussetzung, dass unser Reichtum, also der Reichtum der westlichen, industrialisierten Länder auf der Armut der anderen beruht, wir also schuld an deren Elend sind?
Pogge: Nein. Wir haben moralische Hilfspflichten, die lebensbedrohliche Armut anderer zu lindern, auch wenn wir nicht selbst zu ihrer Verursachung beitragen. Aber in der Welt, wie sie ist, ist Ihre Voraussetzung ja erfüllt! Wir haben uns begünstigende Marktregeln formuliert und durchgesetzt, unter denen die ärmere Hälfte der Menschheit, mit ihrem inzwischen unter 3 Prozent geschrumpften Anteil am weltweiten Haushaltseinkommen, ihre Grundbedürfnisse nicht sicher abdecken kann. Mit diesen ungerechten Regeln töten wir Millionen.
Schlüter: Vor diesem Hintergrund müssten wir also von Massenmord sprechen, weil wir nicht nur nicht helfen, sondern willentlich den Tod anderer herbeiführen.
Pogge: Genau das tun wir, wenn wir etwa ärmere Bevölkerungen durch allerlei Handelshemmnisse an der gleichberechtigten Teilnahme am Weltmarkt hindern.
Schlüter: Wir tun das, weil wir uns das leisten können. Schließlich sind wir die Stärkeren.
Pogge: Aber ist das im Sinne unseres wohlverstandenen Eigeninteresses? Wir leisten uns eine globale Wirtschaftsordnung, die sich in Hinblick auf ihre Bestimmung, nämlich das Wohl aller Menschen zu befördern, als ineffizient und auch höchst ungerecht erweist. Wir können hier auch, was die Versorgung der Menschen mit lebensnotwendigen, ihnen ein würdiges Leben ermöglichenden Gütern angeht, von einem eklatanten Marktversagen sprechen. Das hat mittlerweile schwere, womöglich irreparable Folgen, wie sich an den Beispielen der Finanzkrise oder des Klimawandels deutlich zeigt: Nicht nur lassen wir andere für uns verhungern, sondern gefährden auch uns selbst. Deswegen bedarf unsere Lebensform einer nachhaltigen Veränderung.
Schlüter: Kommen wir damit auf die von Ihnen angesprochene Makroebene. Sie haben den Klimawandel bereits erwähnt, fangen wir also mit einem ganz konkreten Beispiel an: Ein schwäbischer Tüftler hat eine neue Technologie zur solaren Energiegewinnung erfunden, mit sehr hohem Wirkungsgrad und zu sehr günstigen Herstellungskosten. Er meldet seine Erfindung zum Patent an und will damit Geld verdienen. Wie kommt jetzt das Gute in die Welt?
Pogge: Dass er seine Erfindung zum Patent anmelden und schützen lassen kann, ist an sich nicht schlecht. Die Frage lautet allerdings, was damit eigentlich geschützt wird. Mit einem heutigen Patent beansprucht er, dass nur er über seine Erfindung verfügen kann, gewissermaßen ein Monopol besitzt. Allerdings wird ihm das exklusive Verfügungsrecht nur zeitlich befristet zugesprochen – irgendwann läuft das Patent wieder aus. Ich betone diese Befristung, um den konventionellen Charakter des Schutzes geistigen Eigentums zu beleuchten. Das kann uns helfen, besser zu verstehen, warum wir uns auch ein ganz anderes Patentrecht vorstellen können – etwa folgendes: Der schwäbische Erfinder meldet seine neuartigen Solarzellen zum Patent an, bekommt damit aber keine exklusiven Verfügungsrechte, sondern ein Anrecht auf staatliche Prämien, die sich nach der durch seine Erfindung tatsächlich erzielten Verringerung des Kohlendioxydausstoßes richten. Unter einem solchen Belohnungssystem wäre die Erfindung von Anfang an viel billiger und würde dann auch viel schneller und weiter in Umlauf kommen – in China zum Beispiel, wo es einen sehr großen Bedarf für alternative Technologien zur Energiegewinnung gibt. Und das wäre von großem Nutzen für die Menschheit, insbesondere für zukünftige Generationen.
Schlüter: Doch wo kommt das Geld für diesen Solar- oder Energiefonds her? Und wie soll der geldwerte Erfolg der Erfindung ermittelt werden? Sie müssen dem Erfinder schon einiges bieten, dass er auf sein geistiges Eigentum verzichtet.
Pogge: Das Geld für den Fonds käme aus Steuermitteln, schließlich steht die Erfindung der Allgemeinheit zur Verfügung. Und was die Messung des Erfolgs angeht: Sie können ermitteln, wie viel weniger Schadstoffe die neue Technologie im Vergleich mit einem konventionellen Kohlekraftwerk produziert. Wenn solcher Erfolg belohnt wird, hat der Erfinder ein Interesse daran, eine möglichst gute Technologie zu entwickeln: Je höher der Wirkungsgrad seiner Solarzellen und je günstiger ihre Herstellungskosten, desto mehr werden davon gebaut, desto geringer ist der Schadstoffausstoß und desto größer die Prämie vom Energiefonds. Insofern hat der Erfinder auch einen Anreiz, für seine Erfindung zu werben und für ihre kostengünstige Massenproduktion zu sorgen – sofern sie wirklich Nutzen bringt.
Schlüter: Mit diesem Fonds schaffte der Staat finanzielle Anreize für gesellschaftlich nützliche Produkte oder, mit anderen Worten: Der Staat griffe regulativ in das Marktgeschehen ein, ohne den Wettbewerb einzuschränken. So ließen sich moralisch begründete Staatsziele in der Wirtschaft implementieren. Doch was ist, wenn es klar widerstreitende Interessen aufseiten der Wirtschaft gäbe? Ein Pharmakonzern zum Beispiel will Medikamente verkaufen und hat, streng genommen, ein klares Ziel: Weder will er, dass die Menschen sterben, noch dass sie ganz gesund werden – beides würde ihn nämlich nichts mehr verdienen lassen.
Pogge: Ihre Logik macht Sinn für den Fall, dass es nur eine Pharmafirma gibt. Doch unter den Bedingungen des Wettbewerbs sieht die Lage ganz anders aus. Es wird sich immer ein Unternehmen finden, dass mit seinem Medikament den Markt erobern möchte, und dies wird ihm nur gelingen, wenn es ein besseres Produkt anbieten kann, z.B. eines, das Menschen tatsächlich heilt, anstatt sie dauerhaft abhängig zu machen. Sie dürfen nicht mit allzu viel Solidarität zwischen den Wettbewerbern rechnen. Einer wird immer ausscheren.
Schlüter: Ihnen scheint eine Art globale Ordnungspolitik vorzuschweben, denn Unternehmen operieren heute weltweit. Dafür sehe ich allerdings kaum Ansätze. Nehmen Sie nur die Bekämpfung der Menschheitsgeißel Aids: Noch immer gibt es für die meisten Menschen keine billigen Medikamente. Wer auch sollte das durchsetzen? Die Vereinten Nationen?
Pogge: Nein, die UN gewiss nicht. Die sind allein wegen ihres bürokratischen Apparats viel zu umständlich. Ich arbeite seit einiger Zeit an einem Projekt, dem Health Impact Fund (HIF). Damit sollen Entwicklung und Vertrieb günstiger Medikamente vorangetrieben werden. Die Arbeitsweise dieses Fonds wäre sehr unbürokratisch und damit auch effizient: Die Pharmakonzerne melden ihre Erfindungen beim HIF und verpflichten sich damit, das Medikament zum niedrigstmöglichen Produktionspreis zu verkaufen. Belohnt werden sie dann, für eine bestimmte Zeit, mit Prämien, deren Höhe sich nach dem aus der Erfindung tatsächlich erwachsenden Gesundheitsgewinn richtet.
Schlüter: Damit verzichteten die Konzerne auf ihr Monopol, es wäre gewissermaßen strukturell ausgeschlossen.
Pogge: Ja. Trotzdem würden sie ihre Forschungsauslagen wieder hereinholen können und wären somit in der Lage, auch weiterhin in die Forschung zu investieren. Zugleich hätten wir es mit einem Anreizsystem zu tun, denn die Bezahlung aus dem Fonds hinge davon ab, wie viel ein Medikament tatsächlich zur Krankheitsbekämpfung beiträgt. Die Pharmaunternehmen hätten insofern ein gesteigertes Interesse daran, wirkungsvolle Produkte auf den Markt zu bringen. Nicht zuletzt bestünde für sie auch ein Anreiz, ihr Produkt billig zu produzieren und zu verkaufen, denn je billiger ein Medikament angeboten wird, desto mehr wird davon verkauft und desto größer ist dann sein gesundheitsförderlicher Effekt und somit auch die Belohnung für die Erfinderfirma.
Schlüter: Bleiben trotzdem immer noch die Pharmakonzerne: Können die wirklich ein Interesse an optimal versorgten Menschen haben – sie verlören ihre Kundschaft.
Pogge: Die Pharmaindustrie als Ganze wohl nicht, aber jede einzelne Firma schon. Und das wird vom HIF ausgenutzt. Das zurzeit herrschende Anreizsystem führt zum einen dazu, dass Menschen unnötig leiden und sterben. Zum anderen lässt es die Forschung auf Medikamente konzentrieren, die den Herstellern die größten Gewinne versprechen, statt auf solche, die zu den größten Verbesserungen für die Gesundheit der Menschheit führen würden. Warum tun wir uns das an? Wir haben es hier mit einer erstaunlichen Verschwendung vor Ressourcen zu tun. Die kapitalistische Marktordnung ist nicht per se vernünftig. Sie bedarf der Regulierung, und zwar auf eine Weise, die den Wettbewerb zur optimalen Beförderung des Gemeinwohls strukturiert. Das Beispiel vom Health Impact Fund illustriert diesen Punkt.
Schlüter: Jetzt müsste sich nur noch eine Volkswirtschaft finden, die sich auf ein solches System umstellen würde.
Pogge: Der HIF sollte weltweit operieren. Dadurch würde sein Nutzen (billiger Zugang zu neuen, hochwirksamen Medikamenten) maximiert und seine Finanzierungskosten (Erfinderprämien) breit verteilt. Der HIF bräuchte mindestens 6 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist keine allzu große Summe – gemessen an den Vorteilen schon gar nicht. Wegen seiner Gemeinwohlorientierung kämen die Gelder aus dem Steuereinkommen. Für uns Steuerzahler wäre das ein klarer Deal: Weil der Health Impact Fund ein besonders effizienter Weg ist, pharmazeutische Forschungsanreize zu setzen, ist ein Anstieg der volkswirtschaftlichen Gesamtausgaben für die medizinische Versorgung nicht zu erwarten; was wir als Steuerzahler verlieren, würden wir als Käufer von Medikamenten und durch billigere Krankenversicherung zurückgewinnen. Und wenn die finanzielle Bilanz doch negativ ausfallen sollte, bekämen wir dafür wichtige neue Medikamente, die ohne den HIF nicht entwickelt worden wären. Zudem wäre jedes hier gemeldete Produkt bei gleicher Wirksamkeit kostengünstiger als jedes nicht gemeldete. Wir, Patienten und Steuerzahler, bekämen in jedem Fall etwas für unser Geld.
Schlüter: Und weil wir Steuerzahler auch Wähler sind, gibt es gute Chancen für die Realisierung des Fonds?
Pogge: Auch hier sollten wir realistisch sein. In den USA können Unternehmen ganz legal die für sie passenden Gesetze kaufen – das läuft über ihre Lobbys und Industrieverbände. Demokratisch ist das nicht. Ich sehe aber eine große Chance für Europa. Als Weltmacht hat es seinen Höhepunkt überschritten. Doch noch ist Europa eine der drei großen Handelsmächte – neben den USA und dem aufsteigenden China. Deswegen bietet sich den Europäern jetzt die Chance, ihre Volkswirtschaften zu einem globalen Modell umzubauen, das nicht nur technologische und medizinische Neuerungen produziert, sondern auch Vorbild für ein gemeinwohldienliches Wirtschaften wäre, das auch global umgesetzt werden könnte. Anstatt engstirnig nur an unser Eigeninteresse zu denken – etwa in den Diskussionen über den EU-Beitritt der Türkei und über unsere Agrarsubventionen und andere Handelsprotektionismen –, sollten wir jetzt auf eine gerechtere Weltordnung hinarbeiten, die unsere Interessen auch dann schützen wird, wenn unsere Machtposition sich, wie erwartbar, weiter abschwächen wird.