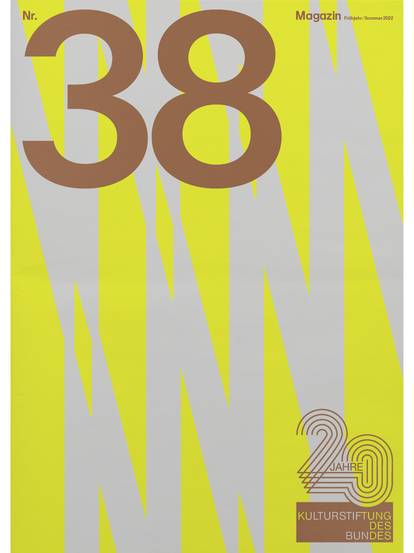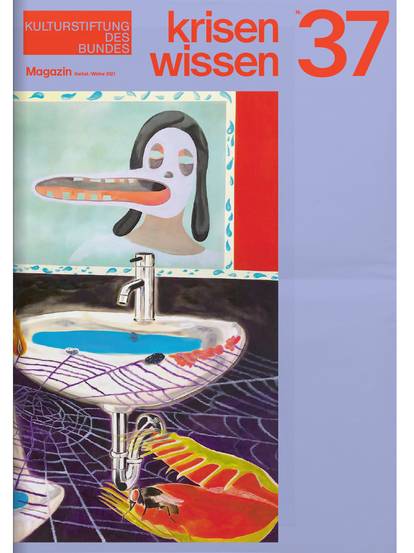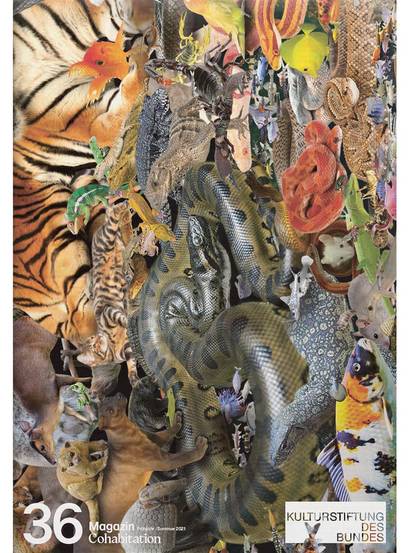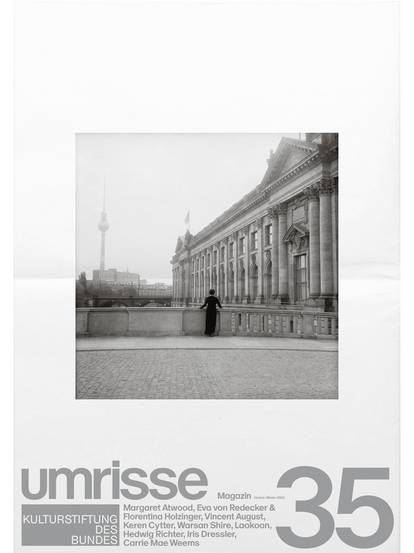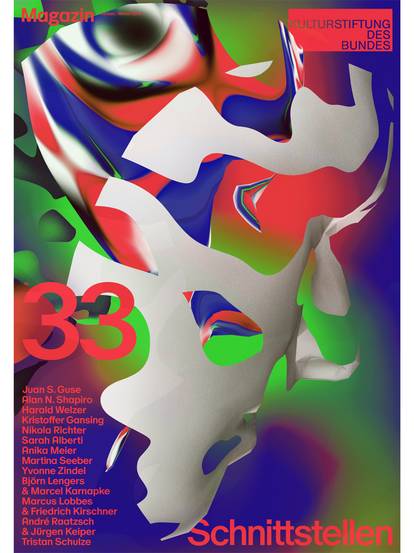Seit der industriellen Revolution avancierten Städte zum bevorzugten Ort der Kulturproduktion und prägten das kulturelle Selbstverständnis ihrer Bewohner. Im Programm Kunst und Stadt greift die Kulturstiftung des Bundes die aktuellen Veränderungen der kulturellen Infrastrukturen im umfassenden Blick auf gegenläufige Tendenzen auf: Das explosive Wachstum von Megastädten und das von Bevölkerungsabwanderung und ökonomischem Niedergang gekennzeichnete Schrumpfen von Städten. Werner Sewing fragt danach, welche Rolle Kultur in den Städten, in der kommunalen Kulturpolitik, heutzutage spielt und welche Bedingungen umgekehrt Städte im Zeitalter der Globalisierung für die Kultur bieten.
Als sie noch die Gegenwelten des überwältigenden Landes waren, konnten Städte als Orte des kulturellen, sozialen und politischen Fortschritts gelten. Später waren sie in einer verstädterten Industriegesellschaft zwar immer noch Kristallisationspunkte von Kultur, diese aber war längst universal und ubiquitär. Heute wird nun im Gefolge der Globalisierung immer deutlicher, dass der Standortcharakter der Stadt, ihre ‹Immobilität›, sie immer abhängiger von den mobilen, flüssigen Potenzen, von Kapital und Kultur, werden lässt. Diese sind die entscheidenden Global Players, um die sich die konkurrierenden Standorte bemühen müssen. Es sind die Standortentscheidungen der Wirtschaft, die Regionen und Städte wachsen oder schrumpfen lassen. Kultur hingegen als hochgradig sensibles Organ der symbolischen Selbstdefinition von Menschen verarbeitet diesen Wandel, sie ist Seismograph und Laboratorium zugleich.
In den Wachstumszentren, in München, Hamburg, Frankfurt am Main oder im boomenden Großraum Köln sind Kunst und Kultur längst Teil einer aus Hochkultur und Massenmedien gespeisten ‹symbolischen Ökonomie›. Sie partizipieren an der wirtschaftlichen Dynamik kompensatorisch oder kritisch. Dass Kultur selbst zum endogenen Wachstumsfaktor einer Region werden kann, ist aber selbst für Los Angeles nur sehr bedingt richtig und trifft vor allem für die marktgängige Massenkultur zu. Diese war immer schon ein Ferment großstädtischer Dynamik, mittlerweile aber längst globalisiert und fast überall zugänglich.
Die Lektion der erfolgreichen Metropolregionen lässt nun auch Schlussfolgerungen für die schrumpfenden Regionen und Kommunen zu. Hier ist mit dem Abbruch der Industrie Kultur zusehends zu einer Überlebensstrategie geworden, sie erschließt brachliegende Potenziale der Selbsthilfe, schafft neues Selbstbewusstsein mit dem Rücken zur Wand. Vom postmodernen Lifestyleaccessoire wird Kultur wieder zum Grundnahrungsmittel symbolischer Selbstbehauptung, zur kommunikativen Währung sozialen Kapitals.
Kultur sei Kompensation für die Verluste, die uns die Moderne mit ihrem ständigen Wandel zumutet, so die konservative These. Kunst und Kultur seien produktive Interventionen in die Gesellschaft, so die These nicht nur der Avantgarden der zwanziger Jahre.
Bis vor kurzem schien Kultur als fester Bestandteil jeder Stadtpolitik vor allem kompensatorisch zu wirken, als touristische Vermarktung der Mythen, als Attraktion für qualifizierte Arbeitskräfte, als Lifestyleaccessoire der neuen Mitte.
War seit den sechziger Jahren immer häufiger von einer Krise der Städte die Rede, von der Flucht der Besserverdiener in die Vorstädte, so wurde mit der zunehmenden Ästhetisierung der Lebenswelt Kultur zu einem Pfund, mit dem die alten Zentren wuchern konnten. Stadt braucht Kultur mehr denn je, die Zentren der Städte leben neben dem Tourismus auch von der Vorliebe künstlerischer Milieus für innenstadtnahe Quartiere. In der Konkurrenz von Downtown und Suburbia wird die Kunstwelt mit ihren Galerien, Museen und Lokalen zu einem Träger der ‹alten› Urbanität, während die Alltagskultur mit ihren Multiplexen und Malls flächendeckend die Regionen bespielt. Die Ideologie der europäischen Stadt hat allzu lange die Spaltung von Zentrum und Peripherie ignoriert. Die stetig wachsende Suburbia ist als Ort kultureller Praxis noch nicht entdeckt. Aber auch in der Spandauer Vorstadt, in Schwabing oder Islington ist die urbane Anmutung der ‹Europäischen Stadt› durchaus trügerisch. Kunst als innovative, lebensnahe Provokation, einst ein Element metropolitaner Kultur, ist in der neuen Urbanität im Sandkasten für ‹Junge Wilde› domestiziert, als Brutkasten des Branding.
Ist Stadt noch ein Abenteuer? Braucht innovative Kunst noch die Stadt, außer als Verkaufsort? Kunst besetzte immer schon, lange vor der Ars Electronica einen virtuellen Raum, dessen Protagonistinnen sich wechselnder Standorte bedienen. Kunst ist ein räumlich ungebundenes ‹autopoetisches› System.
Der reale Ort ist dabei für die Kunst nur ein möglicher Standort von vielen für eine geistige Auseinandersetzung, deren Regeln aber immer schon, unter den Bedingungen der Globalisierung aber umso definitiver, universal sind. Marthaler ist nicht Zürich, Rebecca Horn nicht Berlin. Stadtbezogen sind zwar viele Themen der Kunst, in dem Maße in dem die Verstädterung zu einem globalen Thema geworden ist. Detroit und Dessau als Orte hingegen sind aber nur Rohmaterial für Interventionen der Kunst, sie stößt erst in diesem Prozess der Aneignung des Ortes auf den Eigensinn der Städte oder Regionen, eine häufig unsanfte Begegnung. Erst hier ergibt sich auch die Chance einer ‹site specificity›. Es ist aber eine Illusion, hier eine neue Regionalkultur entstehen zu sehen, die eine ganz unverwechselbare kulturelle Identität ausdrückt. Thüringische Concept Art hat mehr mit japanischer Concept Art gemein als mit der Gemütlichkeit der Weimarer Lokalkultur. Regionale Kunstszenen insbesondere in der ‹Provinz› definieren sich gewöhnlich eher in einer Anti-Haltung zur Umwelt. Kunst sorgt durch ihre interne Organisation in überregionalen Netzwerken nicht für eine Regionalisierung der Kultur, sondern für eine Glokalisierung der Provinz.
Wie die Geschichte der erfolgreichen Kulturmetropolen zeigt, ist die Entstehung von Kunst ohne regionale Milieus und Szenen schwer vorstellbar. So lebt das Zentrum des deutschen Kunstbetriebs, Köln, bis heute von seiner Erfindung durch ein Netzwerk ‹kultureller Unternehmer› in den sechziger Jahren. Vorher gab es keine Kunststadt Köln. Versuche Frankfurts, mit Köln gleich zu ziehen, schlugen aber fehl, Berlin tut sich trotz produktiver Künstlerszenen mangels kaufkräftiger Nachfrage schwer, während Basel mit seiner Kunstmesse und ihrem Ableger in Miami als globale Umschlagsorte von Kunst reüssiert.
Genau genommen lebt Kultur vor allem von einmaligen Konstellationen von Akteuren, die Städte müssen ‹lediglich› Talente und Publikum beisteuern, sofern diese nicht importiert werden können. So sehr die Stadt auch der Resonanzboden von Kultur ist, so entscheidend ist aber letztlich die Fähigkeit zur Erschließung des überörtlichen, zumindest nationalen, zunehmend aber internationalen Marktes. Das gilt vor allem für die erfolgreichen Großregionen wie Los Angeles und London, die Zentren des Crossover zwischen Kunst und Design. Hier ist eine durch eine konzentrierte Medienkultur gestützte symbolische Ökonomie zwischen Eliten- und Massenkultur entstanden, welche die städtische Ökonomie durch globale mediale Diffusion in die entstehende weltweite Populärkultur profitabel einspeist. So wurde ‹Swinging London› zur Matrix einer Weltkultur. Die Leistung der Kunst für die städtische Kultur besteht daher, jenseits von Folklore und Heimatkunst, in der Öffnung des Ortes zur Welt. So definieren internationale Kuratorinnen die documenta und damit auch die Wahrnehmung Kassels in der Welt. Gerade auch periphere oder krisenhafte Stadtregionen, neben Kassel etwa auch Bilbao, profitieren von diesem Anschluss an das internationale Kunstnetzwerk. Gerade die ‹Heimatlosigkeit› und ‹Flüssigkeit› des Mediums Kunst, seine fast unbegrenzte Fähigkeit, konkrete Prozesse vor Ort aufzunehmen und neu zu kodieren, versetzt sie in die Lage, in der ‹Ökonomie der Aufmerksamkeit› (Georg Franck) auch schrumpfende Städte und Regionen in Orte zu verwandeln. Kunst kann wie kein anderes Medium die Potenziale einer Stadt freilegen und in den symbolischen Kreislauf einspeisen, in dem ihre kulturelle Wahrnehmung überhaupt erst möglich wird. Sie kann den Gegensatz von Zentren und Peripherien, von wachsenden und schrumpfenden Regionen nicht aufheben, aber neu formulieren und Beziehungen stiften, die neue Chancen eröffnen.
Mangelnde Investitionen der Wirtschaft können durch Kultur aber nicht ersetzt werden, ebenso wenig kann daher Stadtpolitik Kultur zum zentralen Ziel erklären. Im Gegensatz zu Los Angeles oder London darf in Leipzig zunächst kein sehr hoher ökonomischer Effekt von der Kulturförderung erwartet werden. Staatliche Kulturpolitik ist daher gerade in schrumpfenden Regionen unverzichtbar. Kunst als Intervention und Innovation bedarf hier des äußeren Anstoßes. Als Medium von Netzwerkbildung wird Kunst hier vor allem sozial wirksam werden, in der Förderung der Selbstdefinition von Gemeinden, im Aufbau von ‹sozialem Kapital›, von Identität.
In schrumpfenden Regionen wird die nomadische Kunst vorübergehend sesshaft werden müssen, ohne dem Hang zur kulturellen Kristallisation, zur bloßen Kompensation des Mangels oder zur Gemütlichkeit des Luxus der Leere nachzugeben. In Los Angeles besteht diese Gefahr nicht. In Berlin?