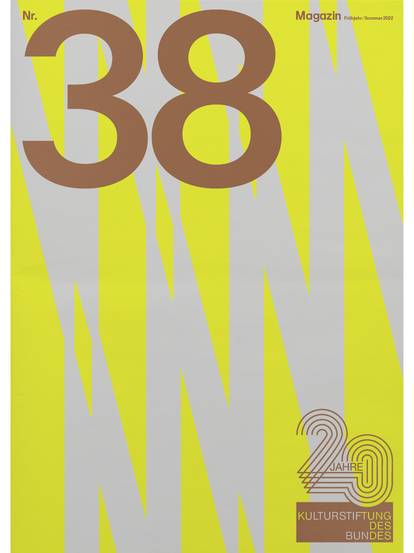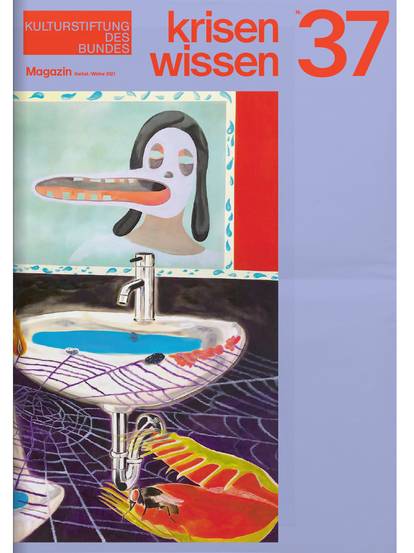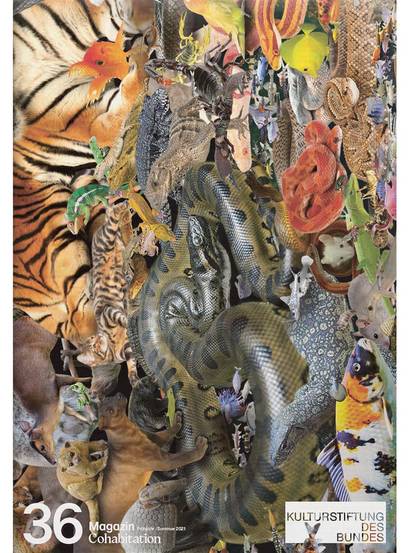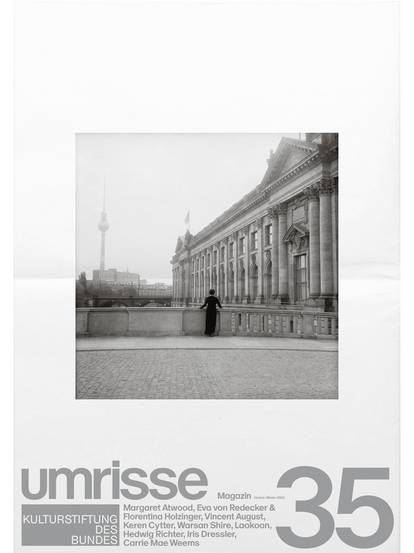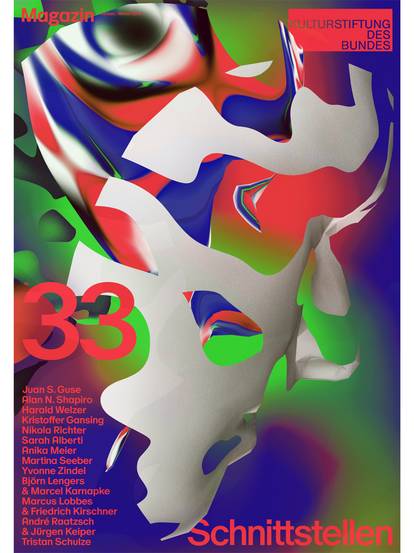Wenn Soldaten für „aufopferungsvolles" Handeln geehrt werden, treten Bilder von Pulverdampf, Schlachtenlärm, Granatsplittern, von Blut und Wunden, von töten und getötet werden vor das innere Auge. Diesen Situationen standzuhalten, sich in ihnen zu bewähren, das stellt seit jeher einen Kern soldatischen Handelns dar, welches im Krieg zu Tage tritt. Darin unterscheidet sich die Existenzform des Soldatischen grundsätzlich vom zivilen Dasein des Bürgers: Letzterem können materielle Leistungen abverlangt werden, können Beschränkungen in unterschiedlichen Handlungsbereichen auferlegt werden − aber dass das Gemeinwesen als ultima ratio auch den Verlust des Lebens abverlangen kann, diese Vorstellung ist uns fremd geworden. Gerade in Deutschland denken wir beim Begriff eines Opfers für das Gemeinwesen (sacrifice) wohl kaum an Soldaten, oder an mögliche Gefährdungen für Polizisten, für Feuerwehrleute, für humanitäre Helfer im Ausland − sondern eher kritisch und distanzierend an frühere Formen einer politischen und ideologischen Überhöhung des Opfers für die Nation, oder auch für das Reich, für die Volksgemeinschaft, für die Rasse. Das Außergewöhnliche und Erklärungsbedürftige an den Kriegen des 20. Jahrhunderts seien gerade, so Benedict Anderson, der mit der „Erfindung der Nation" einen modernen Klassiker der politischen Ideengeschichte vorgelegt hat, weniger das millionenfache Töten, als vielmehr die große Zahl an Menschen, die freiwillig zur „Hingabe" ihres Lebens, zum „höchsten Opfer" bereit waren. Das schließt keineswegs alle Toten politischer Gewalt ein, gewiss nicht. Doch die zeitgenössische Zuwendung zu den Opfern von Gewalt (victim), von Krieg und Gewaltherrschaft, wie die bundesdeutsche Formel seit den sechziger Jahren lautet, hat sowohl die historische Erinnerung an frühere Erscheinungsformen eines aktiven Opfers verblassen lassen als auch ein Verständnis der mythologischen und funktionalen Zusammenhänge zwischen Opfer und Gemeinschaft erschwert. Anders gewendet: Wie kann man vergangene Formen von kultureller Inszenierung und Würdigung des Opfers eines einzelnen für sein Gemeinwesen erstens hinreichend verstehen und zweitens angemessen beurteilen? Eine distanzierende Kritik, welche jede gesellschaftliche Würdigung von Opfern als Opferüberhöhung und als ideologischen Opferkult kritisiert, mag Ausdruck eines modernen, individualistischen Gesellschaftsverständnisses sein, welches indes die Sensibilität für jene Bedingungen ihrer eigenen Existenz verloren hat, die sie selber, mit friedlichen und deliberativen Elementen allein, gegebenenfalls nicht hinreichend sichern und garantieren kann. Insofern kann ein historisch gesättigter und analytischer Blick die Skepsis schärfen sowohl gegenüber ideologischen Überhöhungen als auch gegenüber dem modernen Selbstbild einer aufgeklärten und vermeintlich unabdingbaren zivilen Distanzierung zu jeglicher Form von aktivem Opfer (sacrifice).
Krieg stellt eine besondere Form von Gewaltausübung dar, die erstens organisiert und konzentriert ist und zweitens in besonderer Weise politisch legitimiert werden kann. In der Neuzeit vollzog sich zuerst eine 'Verstaatlichung' des Krieges, in welcher die Gewaltausübung staatlich monopolisiert und konzentriert wurde, was auch eine Steigerung des Gewaltpotenzials durch die Mobilisierung größerer Ressourcen bedingt. Die Heere wurden schlichtweg größer, die Kriegsteilnehmer weiterhin motiviert durch feudal-adlige Ehrvorstellungen, durch materielle Interessen oder primär durch disziplinäre Gewalt zusammengehalten. Eine allgemeine Beteiligung der Einwohner und Bürger jenseits materieller Leistungen war in der Regel nicht intendiert. In seinem politischen Testament von 1768 etwa verwies Friedrich der Große auf das alte Ideal, nach welchem der Fürst Krieg führe und „der friedliche Bürger ruhig und ungestört in seiner Behausung bliebe und nicht wüsste, dass seine Nation sich schlägt, wenn er es nicht aus den Kriegsberichten erführe". Im Kontext der Revolutionskriege und der Befreiungskriege um 1800 dann erfolgte zusätzlich eine ‚Vergesellschaftung' des Krieges, in welcher die zivile Bevölkerung auf neue Weise materiell und vor allem auch ideell ins Kriegsgeschehen eingebunden wurde. Als erste Bürgerpflicht wurde nun nicht mehr „Ruhe" proklamiert, wie es in Berlin nach der Niederlage von Jena im Oktober 1806 plakatiert worden war, sondern die Teilhabe am Kriegsgeschehen. Die freiwillige Kriegsteilnahme des Bürgers, sogleich zur Wehrpflicht verallgemeinert, wurde nun propagiert, von oben, aber auch von unten. Im nationalstaatlichen Rahmen erfuhren antike Vorbilder (pro patria mori) eines Opfers für das Gemeinwesen nun eine Wiederbelebung. Karl Welcker, einer der führenden Vertreter des deutschen Frühliberalismus, lobte dann wenige Jahrzehnte später die „Bürgertugend" als „aufopfernde Bestrebung für das bürgerliche Gemeinwesen", die ihren höchsten Grad in der „Aufopferung", im „Tod für das Vaterland" finde.
Damit war die bis dahin religiöse Idee des „Opfers" als politische Größe in die neuzeitliche Moderne überführt worden. In verschiedensten religiösen Kulturen war und ist das Opfer als kultischer Akt zur Götterbeeinflussung oder zur Heilsgewinnung verbreitet. Das Opfer konnte hierbei eine Ausnahme darstellen oder in zyklische Anlässe integriert sein. Auf einen derartigen jahreszeitlichen Kontext, der den Kreislauf der Natur durch das menschliche Opfer an die Götter sichert und bestätigt, nimmt auch Strawinsky in seinem „Sacre du Printemps" von 1913 Bezug − das Irritierende und Provozierende dieses aus zeitgenössischer Sicht archaischen Opfergedankens auch in akustische Verunsicherungen überführend. Das Christentum stellt insofern keine Ausnahme dar, hat den Opfergedanken jedoch besonders ausgebildet und privilegiert mit der Vorstellung des Opfertodes des Gottessohnes für das Heil des Menschen. Christliche und andere Märtyrerkulte haben diesen Zusammenhang dann übertragen und die Idee des Sterbens für ein zukünftiges Heil in ein dem irdischen Menschen zugängliches Handlungsmodell übersetzt.
Kulturübergreifend und religionssoziologisch kann man das Opfer als Handlung beschreiben, in welcher ein Objekt zerstört oder ein Lebewesen getötet werden. In diesem Akt wird zugleich das Zerstörte aufgewertet, in einen höheren Zustand überführt: geheiligt. − Der moralische Zustand der Person bzw. der Gruppe, die das Opfer vollzieht, wird verändert (Marcel Mauss). Jedes Opfer kann damit auf mindestens drei Bestandteile hin befragt werden: der Opfernde, das Geopferte, die Heiligung. Die Bedeutung des „Opfers für das Vaterland", wie der Tod im Krieg seit dem immensen politischen Mobilisierungsschub bezeichnet wurde, den Revolution und Nation ausgelöst hatten, erschließt sich deshalb erst, wenn man alle drei Dimensionen betrachtet und zusammenhängend analysiert. Die breite Zustimmung zum Gedanken des Opfers für das Vaterland in den westlich-europäischen Gesellschaften seit dem 19. Jahrhundert sollte nicht per se mit einer Kriegsbegeisterung oder gar Kriegsverherrlichung verwechselt werden. Auch der millionenfache Tod im Ersten Weltkrieg hat keinen grundsätzlichen Einstellungswandel herbeigeführt. In vielen westlichen Nachbarländern ist der Einsatz militärischer Mittel noch heute weit selbstverständlicher als in Deutschland. Aber der deutsche Sonderweg der generellen Delegitimierung von Krieg seit 1945 dürfte vor allem auf die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und den nationalsozialistischen Verbrechen zurückzuführen sein.
Doch ging es bei den Darstellungen der soldatischen Opfer, ging es bei den Thematisierungen des Kriegstodes nur um die Frage von Krieg und Frieden? Gerade im langen historischen Bogen betrachtet tritt die Bedeutungsvielfalt des Opfers klar hervor. Die sowohl in bürgerlichen Kreisen wie in erheblichen Teilen der einfachen ländlichen Bevölkerung sowohl 1813 als auch 1914 durchaus verbreitete Bereitschaft, sich am Krieg gegen die napoleonische Fremdherrschaft und Besatzung aktiv zu beteiligen, lässt sich mit dem Verweis auf monarchische Loyalität und nationale Aufwallung nicht hinreichend verstehen. Gewiss, in den zeitgenössischen Texten jener Jahre findet sich immer wieder eine uns heute befremdlich anmutende Bejahung des Sterbens im Krieg. Zur Veranschaulichung seien Stimmen aus 1813 wie aus 1914 angeführt. Ein Berliner Theologiestudent, Friedrich Wilhelm Sachse, schrieb 1813 an seinen Bruder, ebenfalls Freiwilliger im preußischen Heer, „der Einzelne muß untergehen, damit das Ganze hervorgehe ... wir wollen uns opfern für das Vaterland, damit aus edlem Samen edle Früchte hervorgehen". Und der preußische Regierungsrat Häse annoncierte in der Vossischen Zeitung 1813 den Tod seines Sohnes in einem der ersten Gefechte des beginnenden Krieges bei Lüneburg: „Ein so schneller Verlust ist hart, aber es ist tröstend, daß auch wir einen Sohne geben konnten zu dem großen heiligen Zweck. Wir fühlen tief die Notwendigkeit solcher Opfer". Während Krieg am Beginn des 19. Jahrhunderts noch fast als Selbstverständlichkeit angesehen wurde, konnte sich Opferbereitschaft dann etwa im Ersten Weltkrieg durchaus mit einer Ablehnung des Krieges verbinden. In einer nach 1918 massenhaft verbreiteten Sammlung von „Kriegsbriefen gefallener Studenten", von Philip Witkop, finden sich Äußerungen, bei denen einerseits der Krieg prinzipiell abgelehnt wird, andererseits verkündet wurde, „denn das Entscheidende ist doch immer die Opferbereitschaft, nicht das, wofür das Opfer gebracht wird". Das Opfer brachte die Verbindung des einzelnen mit einem „Ganzen" zum Ausdruck, konnte in einem Hegelschen Verständnis das Leben und das Schicksal in einem überindividuellen Sinngefüge 'aufheben'. Das manifestierte sich nicht zuletzt auch darin, dass der Bezug zum Monarchen während des Ersten Weltkriegs schnell und geradezu selbstverständlich verschwand, nur noch Kollektivformeln wie Volk, Vaterland, Deutschland als Sinn dieser Opfer postuliert wurden. Und auch während des Zweiten Weltkriegs dominierte der Opferbezug auf Deutschland, Sterben für den Führer wurde nicht zur populären Formel.
Es geht nicht um die Frage, ob es sich hierbei um 'wahre' Gefühlslagen und Befindlichkeiten handeln mochte oder um Sprachbilder und Verhaltenszumutungen aus romantischem Geist. Es geht auch nicht darum, ob wir die Einstellungen, die hier zu Tage treten, teilen wollen oder nicht. Fruchtbarer ist indes die Frage, welche Beziehung zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen einzelnem Bürger und politischem Gemeinwesen wird hier sichtbar? Der emotionale Überschuss, der einem in diesen Zeugnissen und in vielen anderen Quellen und Äußerungen jener Zeit entgegentritt, ist einer der emphatischen Teilhabe am Kollektiv, am Gemeinwesen, an der gemeinsamen Sache jenseits von Einzelinteresse oder Familienband, jenseits von persönlicher Bekanntschaft oder personaler Herrschaftsbindung. Darin liegt die ‚Heiligung‘ begründet, politisch gewendet: die Legitimierung der politischen Ordnung. Das Opfer, das hier versprochen bzw. gewürdigt wird, stellt eine aktive Handlung dar, wird als bewusster Akt der Aufgabe oder der Selbstaufgabe für ein höheres Ziel beschrieben. Das menschliche Einzelleben wird eingebettet in eine überindividuelle Ordnung – die nicht mehr religiös, sondern säkular gefasst wird. Mit den kriegerischen Nationalstaatsbildungen seit dem 18. Jahrhundert wird die Nation zur zentralen politischen Leitidee. Damit verweist der Tod des Einzelnen nicht auf eine Erfüllung im christlichen Jenseits, sondern findet seinen „Sinn“ im Erhalt und in der Rettung des politischen Kollektivs, als Bedingung für das Weiterleben der anderen Mitglieder dieses Gemeinwesens. Es handelt sich damit um ein aktives Opfer, welches als donum formuliert werden kann, als Gabe (der Regierungsrat, der seinen Sohn für die höhere Sache gegeben hat) oder als sacrificium, als Preisgabe des eigenen Lebens (die studentischen Freiwilligen von 1813 oder von 1914). Von diesem aktiven Opferbegriff, der immer ein Opfer für etwas darstellt, unterscheidet sich der vor allem in unserer Gegenwart seit 1945 im Vordergrund stehende passive Opferbegriff – victima – der das sinnlose Erleiden von Gewalt zum Kern hat und in der bundesdeutschen Formel der „Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ jene andere Dimension des aktiven Handelns und eines bewussten Einsatzes menschlichen Lebens unsichtbar hat werden lassen.
Das spiegelt die deutsche Erfahrung der Verbrechen gegen passive Zivilisten durch den Nationalsozialismus ebenso wie die Wahrnehmung der DDR-Diktatur und der Gewaltausübung gegen die eigene Bevölkerung, verdichtet am 17. Juni und im Mauerbau. Diese historisch gewachsene Prägung begünstigte die normative Distanzierung vom aggressiven Nationalismus und Militarismus, sie erweist sich jedoch in der Gegenwart als zu begrenzt, um neuen demokratischen Anforderungen und politischen Handlungsmodellen gerecht werden zu können. Wenn ein demokratischer Souverän wie die Bundesrepublik Soldaten in Auslandseinsätze schickt, können diese nicht mehr als passive Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft beschrieben werden. Damit ist das sinnhafte Opfer, das sacrifice für politische Ziele, wieder auf die politische Tagesordnung gerückt.
Jede Gesellschaft muss dabei in oft konfliktreichen und schwierigen Aushandlungsprozessen einen Konsens finden, um sowohl politische und militärische Handlungsmöglichkeiten zu bewahren, als auch ideologisierte Instrumentalisierungen und Vereinnahmungen zu begrenzen und zu verhindern. Dieser Spannung kann keine demokratische Ordnung entgehen. Die deutsche Geschichte der letzten zwei Jahrhunderte hat dabei vor allem zur Ausbildung von einseitigen, man könnte sagen, Entweder-Oder-Antworten tendiert. Nach der Genese des modernen, säkularen Opfergedankens im Kontext von 1813, mit einem Nebeneinander von demokratischen Partizipations- und nationalen Einheitserwartungen hat sich in den Einigungskriegen 1864 bis 1871 und vor allem den beiden Weltkriegen eine Entindividualisierung und Überhöhung des Opferbegriff durchgesetzt, die eine Ideologisierung des Krieges beförderte. Nach 1945 schließlich hat die normative Distanzierung hiervon wiederum jegliche Vorstellung einer Sinnhaftigkeit des aktiven Opfers verdrängt.
Es scheint an der Zeit, der Ambivalenz des Opferbegriffs ins Auge zu sehen und das politische Potenzial dieser einst religiösen Kategorie neu zu erfassen. Eine gewachsene und stabile Demokratie sollte in der Lage sein, diese „Ressource“ zu integrieren, ohne verschwenderisch damit umzugehen.
Ist es nicht an der Zeit, die staatsbürgerliche Teilhabe am Schicksal des Gemeinwesens umfassender zu denken und die Erfüllung von Aufgaben nicht an einen leicht anonymisierbaren Staat zu delegieren, der dann schnell als den Bürger bedrohender Moloch darstellbar wird? Wie umfassend ist der Anspruch auf bürgerliche Selbständigkeit und politische Partizipation zu verstehen? Das schließt eben im Letztfall auch den militärischen Schutz mit ein und wertet den Einzelnen und seinen Einsatz auf, und es ist nicht per se undemokratisch. Das unüberbietbare Beispiel hierfür ist bis heute die Gefallenenrede des Perikles, wie sie Thukydides in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges erzählt. 431/30 v. Chr., im ersten Jahr des Peloponnesischen Krieges, lässt er die Athener die ersten Toten des Krieges gegen die Spartaner bestatten. In der Begräbnisrede skizziert Perikles, wofür die Toten geehrt würden. Ausgangspunkt seiner Darstellung ist das eigene Gemeinwesen, die politische Verfasstheit des athenischen Staates. „Aus welcher Gesinnung wir dazu gelangt sind, mit welcher Verfassung, durch welche Lebensform wir so groß wurden" − das bilde den Maßstab, um die Handlungen der Gefallenen zu werten. „Für eine solche Stadt", und damit für diese politische Ordnung seien die Bürger gestorben. Die nachträgliche Sinnstiftung ihres Todes verbindet Thukydides mit der Proklamation der zukünftigen Orientierung für die Lebenden, damit diese sich dieser Verfassung gleichermaßen verpflichtet fühlen mögen. In der Würdigung des Opfers treten die politischen Prinzipien und normativen Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung in den Vordergrund.
Ohne das Bewusstsein eines gemeinsamen Wertbezugs und ohne die Bereitschaft, sich für diesen Wertbezug einzusetzen und ihn gegebenenfalls aktiv zu verteidigen, bliebe jede politische Ordnung fragil und auf das Wohlwollen anderer angewiesen. Das schließt die Bereitschaft, für dieses Gemeinwesen Opfer zu bringen, ein. Je höher der Bürger den Wert seiner politischen Ordnung einschätzt und je mehr er sich als aktives Mitglied dieses Gemeinwesens ansieht, desto größer dürfte das Potenzial für Opfer für das Gemeinwesen sein. Frühlingsopfer und Menschenopfer sind uns fremd geworden – zum Glück. Aber auch die moderne Demokratie kann des „supreme sacrifice“, wie es im Englischen heißt, nicht entbehren. Und sie braucht angemessene Formen, dieses Opfer darzustellen und als vorbildhaft zu würdigen.