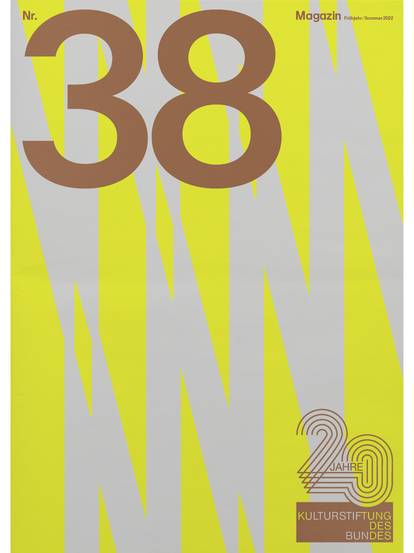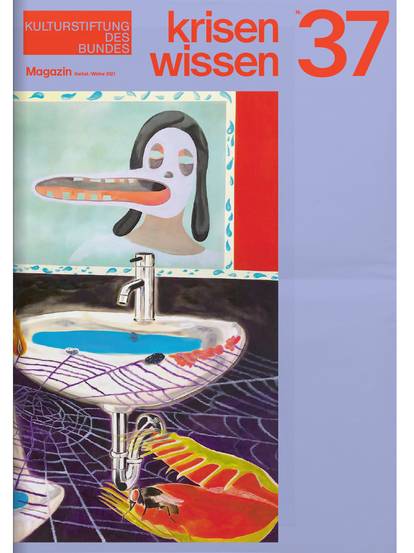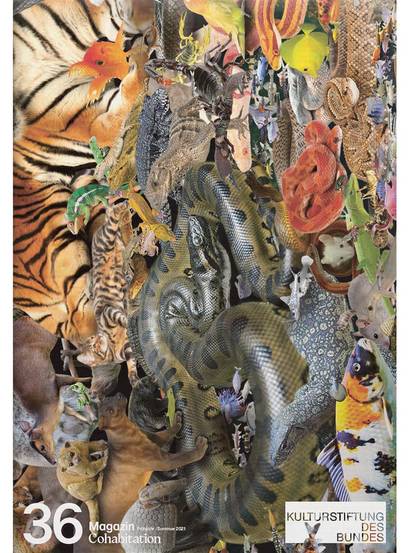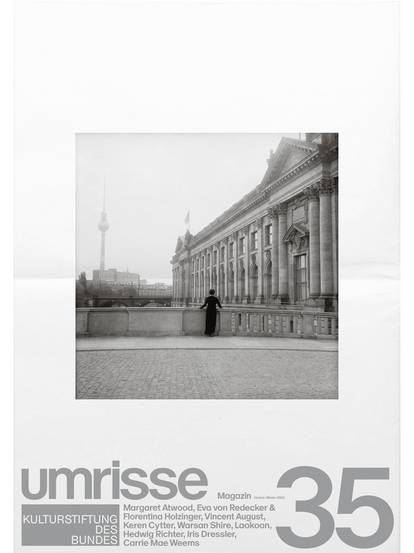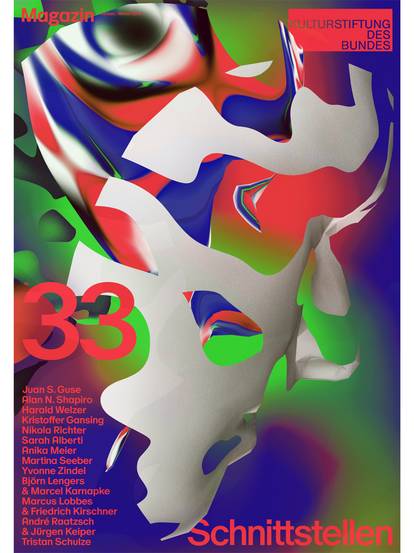„Der Diskurs der Macht erzeugt Ungeheuer.“ (Foucault)
Die Lebenslinie von Europas Roma ist tausend Jahre lang. Ebenso lang, wie die Roma Opfer von Projektionen waren, durch den „bösen Blick“ von Nicht‐Roma erschaffen. Heute schauen Roma zurück, artikulieren sich in der Wissenschaft, der Schriftstellerei, der Bildenden Kunst. Bewaffnet mit postkolonialer Theorie entscheiden sie nun selbst, wie sie sich inszenieren, wie sie in Erscheinung treten möchten. Und sei es als Wahrsagerin, die dem Finanzmarkt das Schicksal aus der Hand liest. Der Autor Manuel Gogos im Gespräch mit der amerikanischen Theoretikerin Ethel Brooks, dem englischen Künstler Daniel Baker, der ungarischen Kunsthistorikerin Tímea Junghaus, der Musikethnografin Petra Gelbart und dem Sinto-Musiker und -Aktivisten Romeo Franz.
Deconstructing the Gypsy
Manuel Gogos: Der „Zigeuner“ ist eine europäische Erfindung. Lasst uns etwas auf die Archäologie dieser Bilder schauen und sie gemeinsam dekonstruieren: diese Projektionen von wilden Männern, lockenden Weibern und verlumpten, aber glücklichen Kindern. Damit kamen den Roma lange in etwa dieselben Attribute zu wie den afrikanischen und asiatischen „Primitiven“ im kolonialen und ethnografischen Diskurs: Ist die Geschichte der Roma in Europa die Geschichte einer „inneren Kolonisierung“?
Romeo Franz: Sie waren eine Randgruppe, wie unter anderem die Juden. Der Antiziganismus ist heute schon über 500 Jahre alt, seitdem gehört er zu Europa. Das Konstrukt des „Zigeuners“ ist ja nur ein Abziehbild von schlechten Sitten, ein Hologramm der Unzivilisiertheit. Und für die Mehrheitsgesellschaft eine Warnung, sich anzupassen.
Daniel Baker: Ich denke, diese Idee des „Anderen“ als Sammelsurium von Ängsten und Sehnsüchten ist vieldeutig. Tatsächlich glaube ich, diese Kolonisierung funktionierte eigentlich wie eine Projektion. Durch verschiedene Mittel haben die Roma sich ja auch selbst von der Mehrheitsgesellschaft unterschieden. Dadurch haben sie eine Art Projektionsfläche abgegeben, auf die wiederum andere ihre Vorstellungen projizieren konnten.
Tímea Junghaus: Aus kunsthistorischer Perspektive lässt sich das bestätigen. Im Panoptikum der Moderne sieht man: Die Künstler Zentraleuropas hatten es nicht nötig, nach Haiti zu fahren. Eben wegen dieser Charakteristika der Roma, der dunkleren Haut, den schwarzen Haaren, der abweichenden Kleiderordnung, besuchten die Künstler einfach die „Kolonie“, die ihnen am nächsten lag: die Roma-Siedlung. Da hatten sie ihre „Primitiven“.
Petra Gelbart: Ich mag wirklich Daniels Idee von dieser reinen Projektionsfläche, die die Roma für die Mehrheitsbevölkerung darstellen. Aber aus der Perspektive der Musikwissenschaft gibt es da vielleicht eine gewisse Spannung. Viele Roma-Musiker, wenn nicht die Mehrheit, identifizieren sich selbst mit eben diesen Stereotypen. Sie sagen: Ja, wir sind eben heißblütig, wir sind leidenschaftlich, das macht gerade unsere Stärke aus! Und das gilt für so verschiedene Musikstile wie Flamenco, der wirklich kaum ohne diese emotionale Komponente gespielt werden kann; aber das gilt eben genauso für Gypsy Jazz, der musikalisch wirklich auf einem völlig anderen Blatt steht. So unterschiedlich sie klingen, so ähnlich wird darüber geredet.
Ethel Brooks: Es gibt wirklich starke Parallelen zum Kolonialismus. Und auch zum Orientalismus. In dem Sinne, wie Edward Said darüber schreibt, dass der Orientalismus wenig mit dem sogenannten „Orient“ zu tun hat, dafür umso mehr mit unserer eignen Welt, dem „Westen“. Das ist wirklich wichtig. All diese Projektionen haben mehr mit den Nicht-Roma, den Gadsche zu tun, als mit den Roma, mit uns. Dass diese Projektionen ein Teil unseres Verhältnisses zueinander geworden sind, das ist eigentlich das Verrückte.
Landkarten, Handkarten
Manuel Gogos: Ethel, du hast beim Festival „Former West“ im Haus der Kulturen der Welt im Jahr 2013 gemeinsam mit Daniel das Panel „A Roma Model / The Cosmopolitan Other“ bestritten. Teil dieser Lecture-Performance war es, dass du, Ethel, aus der Hand gelesen hast, und du, Daniel, hast die Tarotkarten gelegt. Dieser performative Rückgriff auf das Klischee der Weissagungen – ist das eine kritische, auch postironische Form der Wissensproduktion?
Daniel Baker: Bei diesem speziellen Ereignis ging es darum, die Bildwelt der Vorhersage auf eine Spekulation über die Entwicklung der Finanzmärkte zu übertragen. Wir haben diese Bilder also einerseits als Referenz für die traditionellen Formen der Wissensproduktion der Roma selbst benutzt, zugleich aber als Hinweis auf die Mechanismen der Diskriminierung.
Ethel Brooks: Das Hauptaugenmerk liegt für mich auf den verschlungenen Wegen der Wissensproduktion. Sei es bei Vorhersagen für die Finanzmärkte, aber ebenso bei der Ausdeutung der Vergangenheit wie in der Psychoanalyse: Im Herzen all dieser Wissensformen steht immer die Prophetie. Was ich wirklich faszinierend und „sprechend“ fand, war der Furor, den wir damit auslösten. Da gab es auf der einen Seite diese Roma-Aktivisten, die sagten: „Ihr benutzt all diese stereotypen Bilder, damit schadet ihr unserer Sache!“ Und auf der anderen Seite diese schrecklichen Leute, die sagten: „Ihr seid einfach magische Menschen, aber ihr verkauft eure Magie aus ...“
Storytelling
Manuel Gogos: Das Klischee sagt, die Roma sind die Hüter des Geheimnisses, aber sie seien ohne historisches Bewusstsein – mit der Sorglosigkeit von Kindern lebten sie in den Tag hinein. Auch wenn ihre Kultur lange schriftlos war: Sind die Roma nicht im Gegenteil sehr traditionsbewusst? Ist das Storytelling nicht bloß eine alternative Form der Überlieferung? Oder ist das Storytelling am Lagerfeuer wieder bloß ein Klischee?
Daniel Baker: Vielleicht ist das Storytelling ein Klischee, vielleicht auch nicht. Es hat schon eine historische Relevanz, einfach wegen der, sagen wir lieber: Nichtabhängigkeit der Roma vom geschriebenen Wort. Man kann natürlich sagen „illiterat“ oder „schriftlos“. Aber in unserer Art der Kommunikation waren wir eben mehr damit beschäftigt, durch visuelle und performative Formen Bedeutung zu generieren. So würde ich sagen: Der Gypsy als Geschichtenerzähler – das ist ein Klischee, aber eines, das seinen Grund hat in einer sehr alten Tradition, einer alltäglichen Praxis. Stereotype werden von außen an eine Gemeinschaft herangetragen. Aber Symbole können auch innerhalb der Gemeinschaft ihre Bedeutung entfalten. Dazwischen verläuft nur eine feine Linie.
Fahrendes Volk?
Manuel Gogos: Die Roma kamen am Vorabend der Neuzeit in Europa an, in einer Zeit also, da sich die Nationen langsam zu formieren begannen und wo die Verbindung von Land/Herkunft und Identität immer enger wurde. Diese Fremden, die da nun auftauchten, erhoben keinerlei Anspruch auf eigenes Land und auch nicht darauf, eine eigene „Nation“ zu sein. Aber sie waren Grenzüberschreiter, Transnationalisten par excellence. Woran lag eigentlich das Ärgernis der Einheimischen, der Sesshaften?
Petra Gelbart: Ich möchte die Frage umdrehen: Was ist für die Bevölkerungsmehrheit so lästig an der Tatsache, dass die allermeisten der Roma längst selbst sesshaft geworden sind? Ich komme aus Zentraleuropa, entstamme selbst einem Mix aus verschiedenen Roma-Kulturen. Einige davon folgten einem nomadischen Lebensstil, aber das war die absolute Ausnahme! Wir zählen 10 bis 12 Millionen Roma in Europa, wir sind die größte Minderheit, und gerade Zentraleuropa ist eine Region, wo Millionen und Abermillionen Roma leben, und zwar über Jahrhunderte am selben Ort. Und doch wird das ausradiert aus dem Diskurs.
Romeo Franz: Vor zweihundert Jahren hatten meine Urururgroßeltern schon ihre Häuser. Das zeigt für mich, dass da immer schon der Drang war, Heimat auszubilden, sich zu verwurzeln. Das war der Anspruch. Unsere Identifikation ist sehr groß. Mein Großvater hat im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft. Wir sind sogar regionalpatriotisch, wir sind „preußische Sinti“.
Ethel Brooks: Ich denke, in unserer Arbeit geht es auch darum, uns diese Geschichte der Mobilität, diese „nomadische Sensibilität“ zurückzuerobern. Aber eben als komplexe Geschichte, mindestens so komplex wie die Geschichte Amerikas.
Tímea Junghaus: Es ist schon eine großartige Chance, diese Geschichte jetzt aus unserer Sicht zu reformulieren. Dieses sogenannte nomadische Experiment heißt historisch ja vor allem das Durchlaufen verschiedener kleinerer und größerer Genozide: flüchten, sich verstecken, weiterziehen, wieder zum Opfer werden usf.
Im Schutz der Bäume
Manuel Gogos: Jahrhundertelang nahmen die Roma Zuflucht zu den Wäldern. Die galten den Menschen in der „Zivilisation“ der Dörfer und Städte als unübersichtlich, gefährlich. Die berühmte polnische Roma-Lyrikern Bronisława Waj (Papusza) hat einmal geschrieben: „Niemand versteht mich, niemand als die Wälder und Flüsse ...“ War das Leben draußen wirklich Ausdruck einer besonderen Naturverbundenheit der Roma? Oder war auch der Wald eigentlich eher eine Zuflucht, muss also auch diese Beziehungsgeschichte eigentlich politisch gedeutet werden?
Ethel Brooks: In einem tiefen Sinn ist der Wald tatsächlich ein Versteck gewesen. Außerdem durften Roma kein Land besitzen. Ob im Habsburgerreich, in Spanien, Frankreich oder England, überall gab es diese Restriktionen. Wo sollten sie also sonst hin? Und was war ihnen überhaupt erlaubt, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Meine Mutter wuchs mit Pferden auf, sie schlief im Stall oder auf dem freien Feld, bis zu ihrem Tod hat sie eine Nostalgie für diese Lebensform empfunden. Aber der Grund dafür war keine besondere mystische Verbindung zur Natur; es war einfach das, wovon ihre Familie lebte.
Künstler-Bohème
Manuel Gogos: Es gibt diese Negativkonnotationen der Roma. Umgekehrt identifizierten sich auch viele mit ihnen. Die Hippies träumten von der Lagerfeuerromantik dieser „europäischen Indianer“. Und auch die antibourgeoisen Affekte vieler Künstler schienen dem Lebensstil der „Bohemiens“ zu entsprechen. Ein Beispiel wäre die Zigeunerromantik à la Achim von Arnims „Isabella von Ägypten“ oder Federico García Lorcas „Poema del cante jondo“. Sind das Formen der Anerkennung? Oder doch „positive Diskriminierung“?
Ethel Brooks: Es ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts, genauer der romantischen Periode. Und die ist absolut symbiotisch verbunden mit diskriminierendem Rassismus. Ich liebe García Lorca, seine Zigeunerromanzen sind in vielerlei Hinsicht wunderschön. Aber es ist immer noch eine Inbesitznahme des Labels „Zigeuner“. Es ist dasselbe, was zuletzt in dem Song „Drunk in Love“ von Beyoncé passiert, wo sie einfach die Stimme der ungarischer Roma-Sängerin Mitsou reingesampelt hat.
Manuel Gogos: Roma werden gern als „geborene Musiker“ apostrophiert. Dabei wird unterschlagen, dass musikalische Meisterschaft die Frucht harter Arbeit ist. Da gibt es eine Menge Geschichten, wie die des „begnadeten“ Gitarristen Django Reinhardt, der von einer Wohnwagensiedlung bei Paris den europäischen Jazz begründet hat. Oder auch die Erfolgsgeschichte der Gypsy Kings. Woher kommt diese besondere Verbindung zur Musik, wie sie auch in den Klischees von der schönen Carmen oder den ungarischen Csárdás-Geigern anklingt?
Romeo Franz: Ich muss sagen, ich kenne mehr unmusikalische Sinti und Roma als musikalische. Wir kommen ja nicht mit einem Instrument in der Hand zur Welt. Uns prägt einfach das Umfeld. Ich selbst spiele Geige und Klavier. Meine erste Band war ein altmodisches Tanzorchester, wir machten eine Art „Dinner-Musik“. Später habe ich dann meine erste Sinto-Band gegründet, aber wir spielten nicht den ungarischen Csárdás. Die deutsche Sinti-Musik ist eher angelehnt an Django, also Richtung Caféhaus-Musik oder Swing. Nicht dass Sinti und Roma gute Musiker sind, ist eigentlich bemerkenswert, sondern die maßgebliche Beeinflussung berühmter Komponisten wie Liszt oder Brahms durch Roma-Komponisten. Das zeigt, wie die Kultur der Minderheit der ganzen Gesellschaft wichtige Impulse gibt.
Daniel Baker: Die Musik ist die ikonische Kunstform der Roma, innerhalb wie außerhalb der Community weithin akzeptiert. Aber es ist eben nur ein Aspekt ihres Beitrags zur Gesellschaft. Diese Idee, dass ein Roma-Leben unzertrennlich mit dem kreativen Prozess verbunden wäre, in der Musik ist das sehr lebendig, in anderen Bereichen aber fast nicht existent.
Selbstartikulationen in der Kunst
Manuel Gogos: Aber auch in der zeitgenössischen Kunst werden die Roma zunehmend sichtbar. Auch ihren medialen Gegenentwürfen werden immer mehr Bühnen bereitet, Räume geöffnet. Geht es ihnen darum, mit den eigenen Inszenierungen in Erscheinung zu treten, den eigenen Epiphanien?
Tímea Junghaus: Unsere European Roma Cultural Foundation hat in Budapest einen Ort für Gegenwartskunst der Roma eröffnet, genau in einer politischen Situation, als Ungarns Roma tatsächlich kein anderer Ort mehr offenstand. Die Gallery 8 wurde damit zugleich zu einem Ort politischer Intervention, an dem es galt, ihre Selbstentwürfe in die Kunst einzuführen, nicht bloß im Dienste ihrer eigenen Community, sondern auch im Rahmen des europäischen Kunstkontexts.
Ethel Brooks: Für unser Grazer Ausstellungsprojekt „Have a Look into my Life“ wurden alle möglichen Leute befragt: Welche Worte des Romanes sind dir die wichtigsten, welche sind Schlüsselbegriffe? So ging es auch um die Wiederaneignung der Sprache. Um die Rückeroberung der Bildwelt, aber ebenso um die Rückeroberung der Sprache.
Manuel Gogos: Eine wichtige, komplexe Frage erscheint mir auch die nach der Ethnizität in der Kunst: Wenn Roma-Künstler und Intellektuelle wie Gabi Jiménez oder Damian Le Bas sich dezidiert als Roma-Künstler verstehen: Besteht da nicht eine gewisse Gefahr, sich in der Kunst selbst zum „Anderen“ zu machen?
Daniel Baker: Ich denke, es gibt Gelegenheiten, wo die Selbstdefinition als Roma-Künstler nützlich ist, und andere, da ist sie nicht so nützlich. Ich habe das oft mit anderen Künstlern diskutiert. Natürlich versucht jeder von uns, erst mal so viel Aufmerksamkeit zu erregen wie möglich. Und wenn so eine Selbstetikettierung dabei hilfreich ist, dann ist das o.k., jedenfalls für mich. Die Etikettierung kann nützlich sein. In jedem Fall ist es aber eben genau das: nur ein Etikett.
Zigeunerbarock
Manuel Gogos: Matéo Maximoff, einer der ersten Roma-Romanciers – man hat ihn auch als „kulturelles Gedächtnis der Roma“ bezeichnet – beschreibt in seinem Roman „Die Ursitory“ eine Gesellschaft, die nach eigenen Gesetzen und Werten funktioniert. Außenstehenden schien dieses Leben lange äußerst geheimnisvoll. Daniel, du bist selbst ein Künstler, der mit den einschlägigen Symbolen wie „Rosen“, „Hähnen“ oder „Wohnwagen“ spielt. Wollen diese geheimen Zeichen dechiffriert werden? Oder sind sie bloß das Dekor, unter dessen Oberfläche sich deine politische Botschaft verbirgt?
Daniel Baker: Meine Arbeiten der letzten 10 bis 15 Jahre beziehen sich auf etwas, das ich „Roma-Ästhetik“ nenne. Das geht auf meine eigenen Anfänge als Künstler zurück, auf das, womit ich schon als Kind umgeben war, diese spezifische Dingwelt im Wohnzimmer meiner Familie, die irgendwie „beredt“ war und Auskunft gab über die kulturellen und sozialen Werte meiner Gemeinschaft. Das hat Einfluss auf meine Arbeit gehabt, bis heute. Ich möchte verschiedenen Publikumskreisen Einblick verschaffen in diese Roma-Ästhetik, um damit auszuloten, welche Kraft ihr innewohnt, die breite Kultur zu beeinflussen. Mein modus operandi ist also eigentlich die „Infiltration“.
Das Lager
Manuel Gogos: Eines der Leitmotive eurer aktuellen Kunst- und Theorieproduktionen ist ja die Exterritorialität, die Neukartierung, aber auch: das Leben in einem Lager. Historisch waren das die Roma-Ghettos, aber auch die Sklavenviertel, und dann: das Konzentrationslager. Aber ist das nicht noch immer Teil der heutigen Lebenserfahrung allzu vieler Roma? Deportiert zu werden? Als displaced persons in einem Lager zu leben?
Petra Gelbart: Egal, wo und wie Roma wirklich leben: Immer soll es ein Lager sein! Millionen von ihnen leben überall, in Städten und Wohnungen, nur nicht in einem Lager!
Daniel Baker: Trotzdem, es gibt so etwas wie eine Sehnsucht nach dieser Form des Zusammenlebens. Das ist ja die andere Seite des Camps. Diese Aspiration, das gemeinschaftliche Leben wäre etwas Lebendiges, Dynamisches. Und auch darin geht die Diskriminierung weiter. Wenn bei uns in England jemand sein Land nutzen will, um da Wohnwagen für Urlauber hinzustellen, wird man es ihm erlauben. Wenn aber die Gypsies dasselbe wollen, dürfen sie es nicht.
Ethel Brooks: Ich schreibe gerade ein Buch über das Lager (Camp). Darin geht es auch darum: Das Lager wieder zu übernehmen. Ich nutze das Wort „Lager“ ganz bewusst. Es geht darum, ein Stück Geschichte der Roma abzustecken. Und das „Zigeunerlager“ steht nun mal gegen die Monumentalität der Nation.
Porajmos (Genozid)
Manuel Gogos: Über Jahrhunderte waren Sinti und Roma Vertreibungen ausgesetzt, der Marginalisierung und Diskreditierung, und dann auch der biologischen Vernichtung. Von insgesamt 500.000 Sinti und Roma im Machtbereich der Nationalsozialisten haben höchstens zehn Prozent überlebt. Ohne Zweifel ist von einem Völkermord zu sprechen. Und doch wurde bis weit in die Nachkriegszeit geleugnet, dass es sich um eine rassische Verfolgung handelte. Es geht also nicht nur um die Verfolgung durch die Nazis, sondern zugleich um die Verdrehung der historischen Tatsachen und die Verdunkelung der NS-Verbrechen nach 1945?
Romeo Franz: Der Rassismus, in dem nationalsozialistische Pseudowissenschaftler wie Eva Justin oder Dr. Robert Ritter quasi die rassentheoretische Grundlage für die ganze Vernichtung ersonnen haben, der geht nach 1945 eigentlich nahtlos weiter. Denn da saßen die Opfer wieder ihren Tätern gegenüber. Eva Justin stellte bis 1962 im Dienste der Stadt Frankfurt Feldforschungen über die Sinti und Roma an.
Manuel Gogos: Du hast am Denkmal zum Genozid an den Sinti und Roma mitgewirkt, mit deiner Komposition/Klanginstallation „Mare Manuschenge“ / „Unsere Menschen“ – einer Arbeit, die auch unmittelbar mit dem Schicksal deiner Mutter und deiner Großmutter zu tun hat.
Romeo Franz: Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma, hat mich im Jahre 2012 angerufen, man suchte damals einen Geiger, der sollte für das Denkmal genau einen Ton einspielen. Ich hab das versucht, konnte aber diesen Ton irgendwann nicht mehr aushalten. Stattdessen habe ich dann einen Pfiff nachgespielt, mit dem die Sinti nach ihren Kindern pfeifen. Den kennt wirklich jeder von uns, das ist so etwas wie ein Erkennungszeichen, ein Ruf. Den hab ich dann auf die Zigeunermolltonleiter gesetzt. Kurz vor der Fertigstellung des Mahnmals habe ich mich dann mit Dani Caravan, dem israelischen Architekten des Mahnmals, auf der Baustelle verabredet, und der meinte nur: „Das ist es!“ Für mich war das vielleicht das Bedeutendste, was ich in meinem Leben gemacht habe.