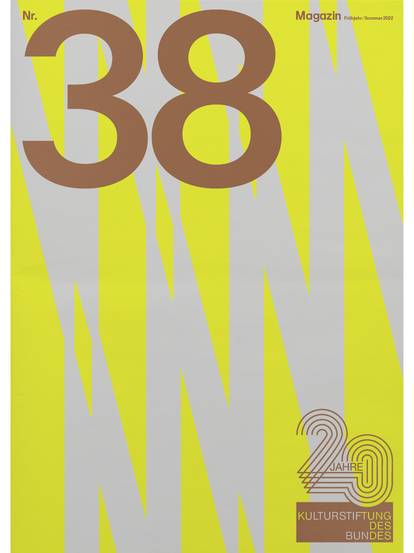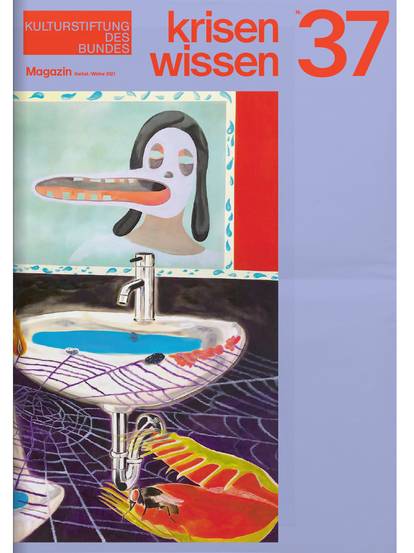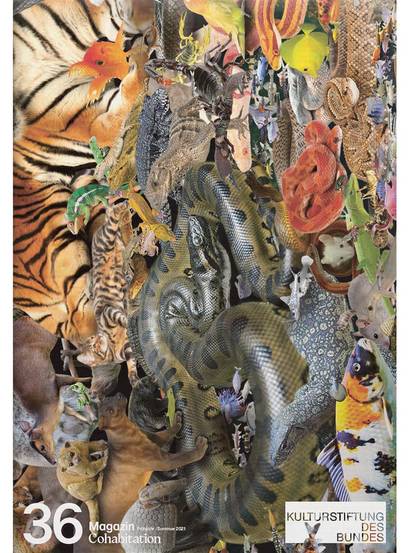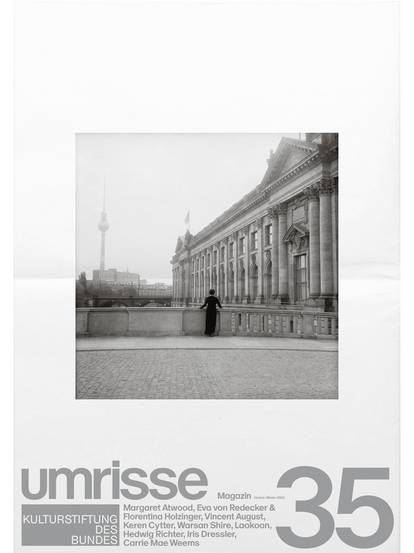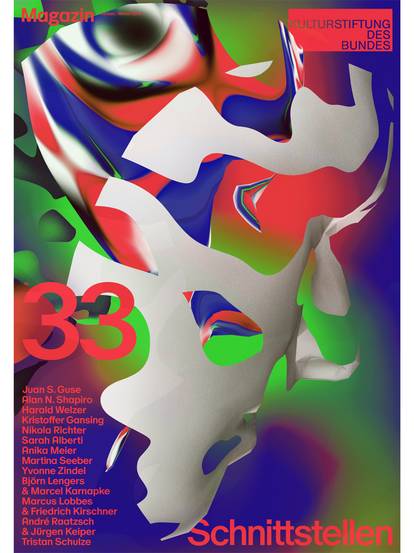Das Festival für Internationale Neue Dramatik (FIND) an der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz widmete sich in seiner diesjährigen Ausgabe (30.3.–9.4.2017) dem Thema „Demokratie und Tragödie“. Die Tragödie, eigentlich eine antike Form, überlieferte die Auffassung, dass der Mensch in konfliktive Situationen geraten könne, die ihn zum Handeln zwingen, und er sich gerade dadurch schuldig mache. Durch Mitleid, Furcht und Schrecken über die auf der Bühne dargestellten Handlungen sollten sich die Bürger/Zuschauer von ihren eigenen, verdrängten Affekten befreien. Wie sieht das heute aus? Welche Konflikte ergeben sich in demokratischen Gesellschaften und welche Möglichkeiten bleiben dem Einzelnen, sich in ihnen zu behaupten? Welche Rolle spielen Emotionen bei der Bewältigung von Konflikten, mit welchen arbeiten Künstler und zu welchem Zweck?
Formal und ästhetisch stehen die zum Festival eingeladenen Regisseurinnen und Regisseure mit ihren unterschiedlichen Regiehandschriften exemplarisch für die Vielfältigkeit des internationalen Gegenwartstheaters. Wir haben drei von ihnen – Angélica Liddell (Spanien), Romeo Castellucci (Italien) und Anne-Cécile Vandalem (Belgien) – befragt, wie sie im Medium ihrer Stücke und Inszenierungen krisenhafte Phänomene demokratischer Gesellschaften bearbeiten.
Die Demokratie ist im klassischen Sinne ein Glücksversprechen für eine größtmögliche Zahl von Individuen. Der „Gesellschaftsvertrag“ von Rousseau, den Sie in Ihrem Werk „Toter Hund in der chemischen Reinigung“: Die Starken ausführlich zitieren, versteht sich als Ausdruck des „Gemeinwillens“ eines Volkes. Dieser zielt auf den „öffentlichen Nutzen“ und das „Gemeinwohl“ ab. Er muss von allen Bürgern ausgehen und auch für alle gelten. Gleichzeitig produziert die Demokratie systematisch Ausgeschlossene. Ist die aktuelle Krise der Demokratie Konsequenz einer „Rebellion der Ausgeschlossenen“?
Angélica Liddell: Die Krise der Demokratie ist keine direkte Folge von rebellierenden Ausgeschlossenen, sie ist eine Konsequenz der Unempfänglichkeit von Mehrheiten für die Rebellion der Ausgeschlossenen. Denn das Problem der Demokratien sind genau die Mehrheiten, die nicht „das Wohl aller“ berücksichtigen, und das ist der kritische Punkt:
Was ist heute das „Gemeinwohl“? Die Demokratie verrät sozusagen das Gemeinwohl zugunsten einer zahlenmäßigen Mehrheit ohne jegliche ethische Qualität. Die Gefahr kann von den Mehrheiten ausgehen, das steht in direktem Widerspruch zu den demokratischen Idealen, aber es ist ein Widerspruch, der ebenfalls seinen Ursprung in einem freien Akt hat. Das heißt, damit die Mehrheiten sich nicht in eine Gefahr, in eine Bedrohung verwandeln, müssen die Demokratien in eine solide Bildung investieren. Die Bildung sollte die Grundlage einer gesunden Demokratie sein.
Ihr Stück weist historische Bezugspunkte auf, so zum Beispiel die Philosophie Diderots und, wie schon erwähnt, Rousseaus. Zugleich sind das Stück und seine Figuren in einer dystopischen Welt angesiedelt, die uns vielleicht noch bevorsteht, in einer Art Science-Fiction. Wieso haben Sie sich für ein Szenario der Vergangenheit sowie der Zukunft entschieden und vermeiden somit die konkrete Gegenwart oder eine realistische, zeitgenössische Welt?
Angélica Liddell: Diese „Polit-Fiction“ („política ficción“) rührt von einem „prophetischen“ Willen her. Wir brauchen Prophezeiungen, und das Zukunftsgenre eignet sich perfekt dafür, die Katastrophen der Menschheit vorauszusagen. Die in der Zukunft angelegte Polit-Fiction erlaubt es einem, gegebene Situationen auf die Spitze zu treiben, bzw. die extremen Konsequenzen der Gegenwart vorauszusagen.
Die Werke, die Sie zitieren, stammen von den Protagonisten der Aufklärung – eine Epoche, in der die Suche nach der Wahrheit im Zentrum des Denkens stand. Was geschieht mit den politischen Ideen und Visionen dieser Autoren in unserer Zeit, die oft als „postfaktische“ Ära bezeichnet wird?
Angélica Liddell: Die Wahrheit darf nicht dem Diktat der Aufklärung unterworfen werden. Die Aufklärung unterwarf den Geist einem System von Schemata, die das transzendente Leben komplett ausrotteten – bis zu dem Punkt, dass wir uns einer politischen Definition des Menschen in allen seinen Facetten unterworfen fanden: seiner spirituellen Erfahrung fremd, fremd der irrationalen Seite, die zu ihm gehört, abgeschnitten von seinen Leidenschaften. Die Aufklärung hat letztlich die Herrschaft der Korrektheit errichtet, gegen die sich selbst Foucault und andere zeitgenössische Denker zur Wehr setzen mussten. Letztlich hat die Aufklärung Korrektheit mit Ausdruck verwechselt.
Welche Bedeutung kommt den Emotionen im Theater heute in diesen „postfaktischen“ Zeiten zu? Sollen wie in der griechischen Tragödie die Gefühle von „Mitleid und Furcht“ geweckt werden? Oder sollen wir uns von diesen Gefühlen befreien (beides sind Optionen, je nach Übersetzung der berühmten Passage von Aristoteles Poetik)? Braucht es weniger oder mehr Emotionen?
Angélica Liddell: Ich denke, wir müssen sogar noch über die Gefühle hinausgehen. Wir müssen in Berührung mit unserer wahren Natur kommen, mit dem „Nicht-Wissen“, das unsere innere Erfahrung definiert, unser tragisches Sein, unser mythisches, prärationales Sein. Das Einzige, was im Reich der Erklärungen noch interessant bleibt, sind die Dinge, die wir nicht verstehen können: Gott, die Liebe, der Tod – und nur das verbindet uns mit dem Kern unseres Wesens. Angesichts des Unbegreiflichen können wir gar nicht anders als in eine Krise geraten: in einen Moment von Beklemmung, von individueller Offenbarung, des Eingeständnisses und der Anerkenntnis der Gewalt in uns. Für uns gesittete, zivile Wesen ist der Widerstand gegen die Barbarei so groß, dass es uns als natürlichste Konsequenz erscheint, unser mythisches „Sein“, unser gewalttätiges „Sein“ zu unterdrücken. Ohne unser mythisches Sein hören wir auf, Mensch zu sein. Deswegen brauchen die Figuren in „Toter Hund“ die Gewalttätigkeit in einer in meinem Stück bereits komplett ausgerotteten Welt. Sie brauchen die Gewalt, um sich als Menschen erkennen zu können. Und wir brauchen die Poesie, um uns in dieser Gewalt wiederzuerkennen, in einer Welt, in der keine poetischen Menschen, sondern politische und ökonomische Menschen erwünscht sind. Das ist eine Katastrophe.
Michel Foucault, dessen Denken in Ihrem Werk ebenfalls sehr präsent ist, hat einmal in seiner Vorlesung „In Verteidigung der Gesellschaft“ gesagt: Die Souveränität entsteht immer von unten, kraft des Willens derjenigen, die Angst haben. Die Angst ist allgegenwärtig unter den Figuren Ihres Stückes, dessen erster Teil sogar „Die Angst“ heißt. Was ist die politische Dimension dieser Angst? Und: Haben wir ihr nicht genügend Beachtung geschenkt in unseren sogenannten westlichen Demokratien?
Angélica Liddell: Foucaults Spur ist im Stück offenkundig. Allein durch den Umstand, verdächtig zu sein, verdient man schon ein wenig die Strafe, sagt Foucault. Das führt dann bis zu dem Punkt, an dem ein anstößiges Verhalten zur Straftat wird. Die Angst gibt vor, wer der Feind ist. Der Gesellschaftsvertrag verbindet die Idee des Feindes mit der Idee der Verteidigung. Die extreme Konsequenz in „Toter Hund“ besteht politisch in der AUSROTTUNG des Feindes. Die spirituelle Konsequenz ist die AUSROTTUNG der Emotionen zugunsten einer scheinbaren Freiheit, in der aber die Repression Politik und private Welt ununterbrochen bestimmt.
Wir sind es gewöhnt, Demokratie als etwas Positives darzustellen. Seit einiger Zeit jedoch werden Konzept und Inhalt der Demokratie mit einer nie zuvor dagewesenen Polemik diskutiert. Man könnte sagen, dass die Demokratie beginnt, Schatten zu werfen. Um welche Schatten handelt es sich?
Romeo Castellucci: Die erste Form der Demokratie bildete sich in einem Land heraus, in dem Sklaverei herrschte. Dennoch ist Athen zweifellos als erste Form einer rechtsbasierten Zivilisation zu betrachten. Daraus lässt sich ableiten, dass das Modell der Demokratie keineswegs so klar und hell ist wie ein wolkenloser Himmel. In seiner prophetischen Analyse des jungen Amerikas zeigte de Tocqueville wider Erwarten die dunkle Seite der Demokratie auf und bezeichnete sie als „Tyrannei der Mehrheit“. „Wenn mein Kopf nicht nur von einem Stiefel, sondern von tausend Stiefeln zerquetscht wird, so wird meine Unterdrückung dadurch nicht erträglicher.“ Solche Sätze nehmen in der heutigen Zeit einen düsteren Ton an.
In Ihrem Werk finden sich zwei historische Bezugspunkte: die attische Demokratie im 5. Jahrhundert v.Chr. und die amerikanische Demokratie im Jahr 1835 aus Sicht des Europäers Alexis de Tocqueville. Warum gerade diese historischen Modelle – und keine zeitgenössischen Betrachtungen und Schauplätze? Was offenbaren sie über die Welt von heute?
Romeo Castellucci: Eigentlich entstand das Projekt „Democracy in America“ schon vor einigen Jahren, lange vor den jüngsten Wahlen in den USA. Ich bin mir bewusst, dass dieses Ereignis die Lesart des Stückes beeinflussen wird. Das könnte irreführend sein.
Vor diesem Hintergrund: Die Idee der Demokratie in diesem Stück bezieht sich zunächst auf Griechenland und später auf die Demokratie, die „In der nordamerikanischen Wildnis“ entstand, wie von de Tocqueville in seinem gleichnamigen Werk beschrieben.
Vor der Geburt der griechischen Demokratie und Politik gab es ein Fest, zu dem die Götter zusammenkamen. Vor Ankunft der puritanischen Pilger mit ihren Siedlungen gab es in Amerika ein Fest, zu dem die Götter zusammenkamen. Was mich dabei interessiert, ist der Bereich dazwischen: das Ende des Fests und der Beginn der Politik, also die Zeitspanne zwischen dem Ende des Fests und dem Beginn der Politik. Man könnte sagen, dass dieses Werk das Ende des Fests und das „Desaster“ der Politik beleuchtet. Man könnte sagen, dass es ein Stück über die Sehnsucht nach diesem Fest ist, die Sehnsucht nach Folklore.
In unseren westlichen Demokratien haben wir zudem die Gewohnheit (oder nutzen den Gemeinplatz), uns auf die Tradition der attischen Demokratie zu berufen: ein politisches Modell, das auch eng mit der attischen Tragödie in Verbindung steht. Die Versammlung der Bürger auf der Agora und das Zusammenkommen im Amphitheater als zwei sich ergänzende Aspekte des gesellschaftlichen Lebens. In Ihrem Werk über die Demokratie in Amerika legen Sie jedoch nahe, dass die Erfahrung der Tragödie „as a political awareness and an understanding of being, has been expunged from modern democracy“. Wieso – und mit welchen Konsequenzen?
Romeo Castellucci: Nehmen wir als Ausgangspunkt dieses allgemeine Verständnis: Die attische Tragödie inszeniert die Dysfunktion des Daseins. Die Macht der Stadt, die hier dargestellt wird, ist ein kranker Körper. Für die Griechen existiert ein negatives Fundament der Politik, ein Labor, in dem die mimetische Gewalt und die Dysfunktion „in vitro“ untersucht werden. Es wird gewissermaßen ein homöopathisches Heilmittel hergestellt.
Man könnte sagen, dass die Wurzel der westlichen Demokratie – die attische Tragödie – ein politisches Antidot der Stadt ist. Die amerikanische Demokratie dagegen wächst empor wie eine Blume in der Wüste. Sie wird von Grund auf neu erfunden. Im Vergleich zum griechischen Modell fehlt hier das Verhältnis zur Ästhetik, zum spirituellen Aspekt der Dysfunktion der Tragödie.
Die Anfänge der amerikanischen Demokratie basieren auf alttestamentarischen Prinzipien, auf dem, was de Tocqueville als „puritan foundation“ bezeichnet.
Ein entscheidendes Element der griechischen Tragödie ist die Wahrheit: ihr zivilisatorischer Aspekt (Was enthält mehr Wahrheit: das geschriebene oder das ungeschriebene Gesetz?), aber auch der zerstörerische, wie im Fall von Ödipus. Was passiert mit der Tragödie in Zeiten der „Post-Wahrheit“?
Romeo Castellucci: Die Tragödie stellte ein mächtiges „antiphrasisches“ Instrument dar, das dazu diente, das politische Bewusstsein der Bürger zu wecken. Dies geschah durch die Freude am Zuhören, am Zuschauen, an der bewussten Täuschung. Die im Entstehen begriffene Politik wurde von ihrer eigenen negativen Grundlage, ihrer „Ungerechtigkeit“, in die Krise gesteuert.
Das Theater duplizierte das individuelle und das kollektive Leben. Der Fehler war fühlbar, man konnte ihn quasi mit der Hand berühren. Das Erstaunliche an all dem war, dass der Fehler mit der Schönheit übermittelt wurde, der Fehler war die Schönheit. Im Bereich der Tragödie war die bewusste Täuschung eine Form höchster Erkenntnis (Gorgias). Diese Täuschung hat nichts mit den Täuschungen und Lügen der Gegenwart zu tun. Die Post-Wahrheit ist lediglich eine Form der Lüge zu gewinnbringenden Zwecken.
Welche Rolle spielen die Emotionen in diesen Zeiten der „Post-Wahrheit“? Auch und vor allem im Theater? Muss – und kann – es noch Emotionen, Angst, Mitleid wecken? Oder (in einer anderen möglichen Übersetzung des berühmten Satzes der aristotelischen Poetik) muss es sich von diesen Emotionen befreien? Braucht es mehr oder weniger Emotionen?
Romeo Castellucci: Gehen wir davon aus, dass sich das Theater außerhalb des Bereichs der Kommunikation befindet. Die Sentimentalität, die durch die Darbietung des „Schmerzes der anderen“ hervorgerufen wird, ist die andere Seite der Medaille des Zynismus. Das Theater zeigt immer und ausschließlich meinen Schmerz. Ich, der Zuschauer, reflektiere mich im dunklen Spiegel der Bühne. Paradoxerweise kann ich sagen, dass der Schmerz auf der Bühne niemals ein Schauspiel ist, sondern eine Sache, die voll und ganz in der Betrachtung des Zuschauers liegt.
Ihr Stück spielt auf einer dänischen Insel mit dem Namen „Traurigkeiten“ und handelt von Rechtspopulismus und einer hysterisierten Medienlandschaft. Warum haben Sie diesen Namen und diesen fiktiven Ort gewählt, um ein aktuelles Thema anzusprechen, um von der Gegenwart zu erzählen?
Anne-Cécile Vandalem: Weil ich die Distanz brauche. Ich brauche die Metapher, um von der Realität zu erzählen. Als ich damit begann, „Tristesses“ zu schreiben, war ich überwältigt von der Angst davor, was aus Europa werden wird mit all den fremdenfeindlichen und antieuropäischen Diskursen von Persönlichkeiten wie Nigel Farage, Geert Wilders oder Marine Le Pen. Und an einem gewissen Punkt fühlte ich mich dermaßen machtlos, unfähig, zu handeln, sie zu stoppen, dass ich mir die ganz naive und brutale Möglichkeit zumindest vorstellen musste, dass sie verschwinden, indem jemand sie umbringt. Eine Freundin gab mir einen Text von Gilles Deleuze über die Traurigkeit zu lesen. Dort steht: „die Traurigkeit ist eine Verminderung unserer Handlungsfähigkeit, ausgeübt durch den Druck eines fremden Körpers auf den unseren. Der Hass ist alles, was man aufwendet, um das Objekt dieser Traurigkeit zum Verschwinden zu bringen.“ Von diesem Schema ausgehend wollte ich eine Geschichte erfinden, in der eine Gemeinschaft buchstäblich von ihrer Unfähigkeit zu handeln überwältigt wird, eine Gemeinschaft, die in ihrer Traurigkeit förmlich ertrinkt. Eine traurige Gemeinschaft, welche eine Insel inmitten des Ozeans bewohnt, die „Traurigkeiten“ heißt.
Wie schon der Name dieser Insel andeutet, spielen Emotionen eine zentrale Rolle in Ihrem Stück, wie auch im aktuellen politischen Diskurs. Wir sprechen sogar vom „postfaktischen Zeitalter“, in dem Gefühle regieren und das Risiko besteht, dass diese von Politikern instrumentalisiert werden. Welche Rolle spielen Emotionen im Theater und besonders in „Tristesses“? Sollte das Theater Mitleid und Schrecken bei den Zuschauern hervorrufen oder im Gegenteil, die Zuschauer von diesen Emotionen reinigen?
Anne-Cécile Vandalem: Das ist eine schwierige Frage … Ich habe große Zweifel an der Wirksamkeit des heutigen Theaters. Manchmal denke ich, es sollte uns fähig machen, gemeinsam Emotionen zu empfinden, damit, wie Georges Didi-Hubermann sagen würde, diese Emotionen dann vielleicht eine Wirkungskraft entfalten, vielleicht sogar eine politische. Aber auf der anderen Seite misstraue ich sehr den Emotionen, die in den Medien verwendet werden, in den aktuellen politischen Kommunikationsstrategien, eben genau weil sie die Macht haben, viele Menschen hinter einem Anliegen zu versammeln. Emotionen sind ebenso nötig wie gefährlich. Aber es ist wichtig, sie verwenden zu können, mit Fingerspitzengefühl, und erst recht ist es wichtig, den populistischen Stimmen nicht das Monopol für Emotionen zu überlassen. Wir müssen wieder lernen, unsere Emotionen zu gebrauchen, aber zum Zwecke des Widerstands, des Protests.
Im Moment erleben wir, wie populistische Bewegungen systematisch unsere Werte verdrehen und die Grenze zwischen Opfern und Tätern zu verwischen versuchen. Rechtspopulisten inszenieren sich und ihre Anhänger als „Opfer einer Diktatur des politisch Korrekten“, als „von korrupten Politikern und der Lügenpresse verratenes Volk“, das „überfremdet“ und von „Minderheiten terrorisiert“ wird. Wie das Schicksal in der Tragödie scheint diese Umwertung eine unausweichliche Dynamik zu schaffen. Gibt es eine Verbindung zwischen demokratischer Freiheit und tragischem Schicksal? Und dennoch haben Sie sich entschieden, eine Komödie zu schreiben. Warum?
Anne-Cécile Vandalem: Zunächst einmal, weil ich wirklich Angst davor habe, was gerade mit uns passiert. Ich habe Angst vor dem, was ich sich ausbreiten sehe, und ich habe ganz ohne Zweifel Angst vor unserem Schicksal. Und das Lachen ist die Distanz, die es mir erlaubt, dieses Thema anzusprechen. Wenn ich hinfalle, wenn ich scheitere oder etwas verliere, muss ich darüber lachen können. Ich bin eine Frau, auch das haben wir lernen müssen, als (falsche) Minderheit: den Spott. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. „Tristesses“ ist zugleich eine Komödie, eine Tragödie und ein Drama. Ich denke, die populistischen Bewegungen treiben die Spaltung unserer Gesellschaften in gegensätzliche Pole mehr und mehr voran. Und ihre Macht rührt daher, dass sie diese Spaltung aufrechterhalten und ihre Konturen weiter schärfen. Wenn man das sieht und versteht, dann fällt es leider nicht schwer, sich vorzustellen, wohin uns das führen wird … und in diesem Sinne handelt es sich vielleicht um ein tragisches Schicksal, das wir voranschreiten sehen, ohne wirklich etwas tun zu können, um uns dem entgegenzustellen.
Demokratie war lange ein Versprechen von Glück, Freiheit, Gleichheit und auch Solidarität für eine größtmögliche Gruppe von Menschen. Allerdings beobachten wir heute, wie unsere westlichen Demokratien systematisch Ausgeschlossene produzieren. Sind diese Ausgeschlossenen der Grund für die Krise der heutigen Demokratien? Wie kann man sie im Theater repräsentieren?
Anne-Cécile Vandalem: Diese Ausgeschlossenen sind wahrscheinlich die ersten Opfer der gesellschaftlichen Spaltung. Sie sind Opfer und Zeugen zugleich. Ich wüsste nicht, wie man sie repräsentieren kann, außer dass man versucht, die Mechanismen zu verstehen, welche Ausgeschlossene produzieren. In „Tristesses“ gibt es die Figur des Pastors, der ein Außenseiter ist, ein Sündenbock. Schon als er klein war, erniedrigten ihn die Kinder auf dem Pausenhof, weil er anders war. Er ist in dieser Dynamik der Ausgrenzung aufgewachsen. Und zwangsläufig wird er sich rächen an der Gemeinschaft, die ihn unablässig ausgeschlossen hat. Er ist es, der sie letztendlich verraten wird. Unsere Gesellschaft produziert überall Sündenböcke, die sich zwangsläufig gegen sie wenden werden, wenn der Moment gekommen ist. Das ist es wahrscheinlich, was wir gerade erleben.
Die Interviews führten Florian Borchmeyer, Nils Haarmann und Friederike Tappe-Hornbostel. Aus dem Spanischen übersetzt von Sima Djabar Zadegan. Aus dem Italienischen und Französischen übersetzt von Florian Borchmeyer und Nils Haarmann.