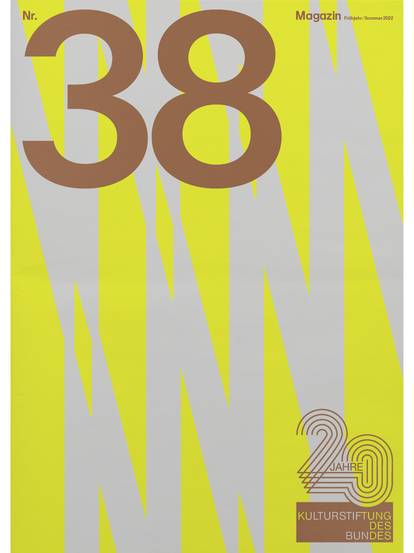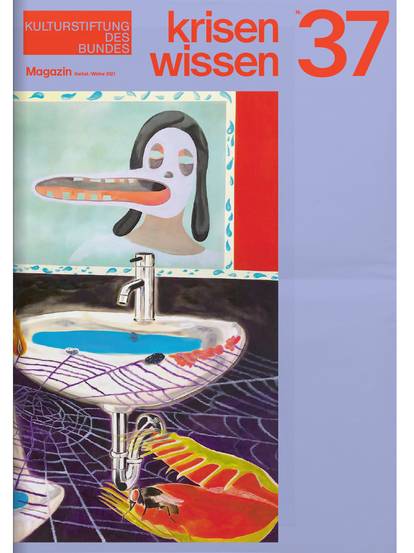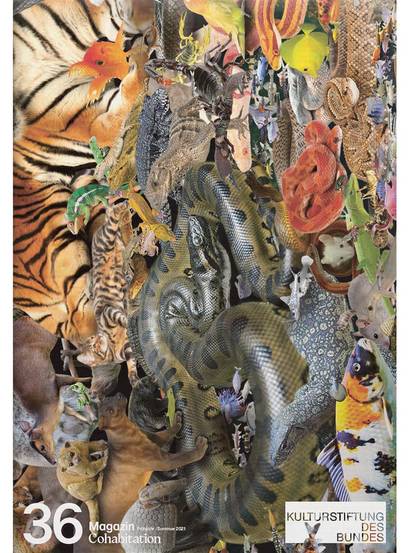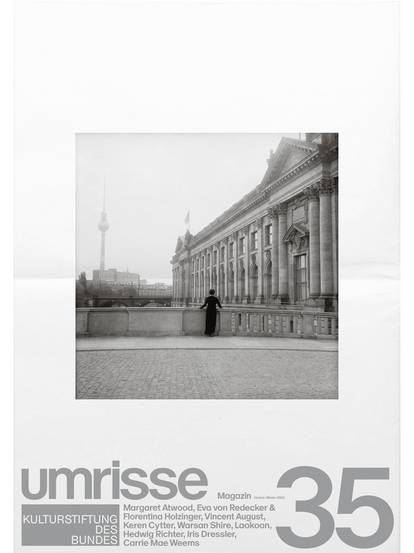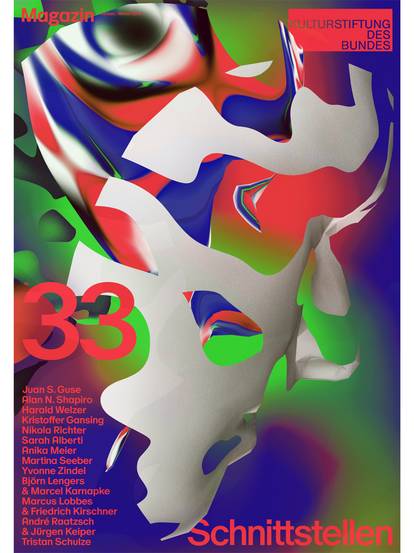Das Land ist kein Ort, sondern ein innerer Zustand, die Sehnsucht nach Rückkehr in eine Vergangenheit, in der alles vermeintlich authentisch war. Über den rücksichtslosen imaginären Landraub von Stadtbewohnern
Wer mit dem Auto aufs Land fährt, hinaus ins Grüne, passiert hinter dem Autobahnzubringer zuerst Abhol- und Möbelmärkte, die mit den geräumigen großen Parkplätzen. Dann Wohnsiedlungen. Dann noch einmal Möbelmärkte. Dann endlich Felder und Wälder, Teiche und Alleen. „Schön ist es hier!“ Schließlich erscheint am Rand der gut befahrenen Bundesstraße das große Schild neben dem alten Bauernhaus. Es zeigt dem Ausflügler, dass er es nun wirklich erreicht hat, das Land: „Antiquitäten“ steht darauf.
Denn die auf dem Land haben noch so viel altes Zeug von früher, dass sie es uns, den Stadtbewohnern, gerne verkaufen. Wir sind kreativ, die sind Archiv. Das Land ist das Territorium der stillgestellten Zeit. Wer aufs Land fährt, fährt in ein geträumtes Gestern, in dem es noch ein bisschen so ist wie früher, mit alten Autos, alten Obstsorten (wo kommen denn die neuen her? – egal), alten Möbeln, alten Bräuchen. Alles Neue kommt aus der Stadt, in Sachen Kultur sowieso: Das ist die Botschaft des erfolgreichen und seit seinem Erscheinen 2002 beharrlich wiedergekäuten Buchs des Soziologen Richard Florida: The Rise of the Creative Class. Das Alte, Ursprüngliche, Authentische dagegen kommt vom Land. Oder genauer: Dorthin fahren die Städter, um es einzukaufen.
Das ist so selbstverständlich, weil das „Land“ als Begriff in dem uns vertrauten Sinn ungefähr so alt ist wie die Eisenbahn, die Fotografie, der Tourismus und der moderne Nationalstaat, etwas mehr als 150 Jahre. Seither ist Land nicht nur eine Gegend, sondern auch das, was Emile Durkheim ein Totem genannt hat: Ein wirkmächtiges Emblem, das ein Kollektiv repräsentiert. Die Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts waren alle dermaßen jung, das sie – abgesehen von cash und Kanonen – nichts dringender brauchten als eine lokale Vergangenheit. Sie brachten das Ländliche in der Form hervor, wie wir es heute kennen. Bunt und pittoresk muss es sein, dabei ganz natürlich – so wie seine Bewohner, ihre Kleider und Gewohnheiten. (Es steckt ziemlich viel Rousseau in dem Konzept.) Erscheinen muss es in vertrauten Formen, reproduzierbar, bildfähig. Der erste Band von Heinrich Riehls Naturgeschichte des deutschen Volkes von 1854 hieß nicht umsonst Land und Leute. Gefördert hat ihn derselbe bayrische König, der Eisenbahnen und Bildungsanstalten baute und anordnete, überall lokale Trachten akribisch zu dokumentieren. (So sind sie entstanden; denn vorher gab es an den meisten Orten keine.) Wandern ging Ihre Majestät auch.
Land ist deswegen in seiner reinsten Form in den Köpfen von Stadtmenschen zu finden, von Kontamination durch Empirie geschützt. Es ist weniger ein Ort als ein innerer Zustand, ein Bilderbogen zur kollektiven Selbstidentifikation: So ursprünglich, naturverbunden und echt sind wir selber. Nachsatz: Wenn man uns nur ließe. Denn „Land“ ist in seinen unterschiedlichen sozialromantischen Aufladungen immer verbunden mit dem Konzept von Widerstand gegen Auswärtiges, Unechtes, Künstliches, gegen die Verlockungen der industriellen Metropolen. Es geht gegen die Römer, um es mit dem Vokabular von René Goscinny zu sagen, dem Autor von Asterix. Der Comic spielt ja nicht umsonst in einem abgelegenen gallischen Dorf, dessen Bewohner ihre lokalen Eigenarten mit Hilfe eines Zaubertranks nach geheimem Rezept erfolgreich verteidigen – der erste Band erschien 1959, auf dem Höhepunkt des Algerienkriegs. Weder dort noch in einem der seither erschienenen 36 Fortsetzungsbände kommt auch nur ein einziger Araber vor.
In Deutschland hat „Land“ schon lange vor der erfolgreichen Zeitschrift Landliebe eine Erfolgsgeschichte als emphatischer Ganzheitsbegriff. Genutzt wurde er von ganz unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums – von der rechtsnationalen „Landvolkbewegung“ der späten 1920er, von völkisch angehauchten Wissenschaftlern der 1930er Jahre wie Otto Brunner und der konservativen „Landesgeschichte“ der Nachkriegszeit bis zu den Grünen und der linken Alternativbewegung der 1970er und 1980er Jahre mit ihrem „Dreyeckland“ in Südbaden und dem „Wendland“ in Niedersachsen: Geträumte Territorien – oder gallische Dörfer – erdverbundener Gegenkultur.
Land ist also nicht nur eine räumliche Kategorie, sondern der Wunsch, mit dem Ausflug ins Grüne in die Vergangenheit zurückreisen zu können. Mit realen Verhältnissen von früher haben diese Bilderbögen antiindustrieller Idyllen ungefähr so viel zu tun wie die bayrischen Trachten Maximilians II. oder Goscinnys tapfere Krieger. Wenn von Land und Landleben die Rede ist, geht es nicht um konkrete Lebens- und Arbeitsverhältnisse, sondern um Bilder. Es sind Passepartouts einer Vergangenheit, die funktionieren, weil man sie mit den eigenen Wünschen ausfüllen kann. Ihre Wirksamkeit beruht darauf, dass sie wie anthropologische Gewissheiten scheinbar zeitlose Gültigkeit beanspruchen. Der Begriff vom „Land“, der in Deutschland so zuverlässig Imaginationen von gut möblierten Herrensitzen und glücklichen Kühen, Deichkaten und Lederhosen, rotwangigen Bauernfamilien und Streuobstwiesen hervorzurufen vermag, ist deswegen eine Bedürfnisanstalt für kollektive Träume von der eigenen Herkunft.
Im 21. Jahrhundert haben Tourismus, Immobilienagenturen und Erlebnisgastronomie das Erbe von Heinrich Riehls Naturgeschichte des deutschen Volkes und seinen Kollegen angetreten. Wie die Inszenierung „historischer Identität“ soll diejenige vom Land als idyllische Vorzeit eine schlichte Tatsache zum Verschwinden bringen: dass die Vergangenheit nie traditionell gewesen ist. Die Agrarproduktion war überall zahlreichen heftigen und einschneidenden technischen Umbrüchen unterworfen und an überregionale Märkte angeschlossen; Migration war der Normalfall. Ein still gestelltes, in sich ruhendes oder autarkes Landleben hat es in den letzten drei Jahrhunderten nirgendwo in Europa gegeben. Dafür entsteht es heute – dank der einschlägigen Fachleute. „Patrimonialisierung“ haben die französischen Soziologen Luc Boltanski und Arnaud Esquerre diesen Vorgang genannt: Die Erzeugung kultureller Intensitätszonen, in denen die Vergangenheit eines Ortes besonders gut sichtbar und leicht konsumierbar wird. Das Land, so zeigen sie, wird deswegen seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts immer ländlicher: Der lukrative Markt für Wochenend- und Zweitwohnsitze gehört ebenso dazu wie der Gastrobereich mit seiner demonstrativen Vermarkung „authentischer“ und „traditioneller“ lokaler Spezialitäten.
Diese Besonderheiten waren nicht immer schon da, sondern müssen erst einmal hergestellt werden − unter Berufung auf Lokales, Historisches, Kultur. Gleichzeitig mit „le patrimoine“ ist deswegen der neue Berufsstand der Kognitionsingenieure des Kulturtourismus entstanden, wie Boltanski und Esquerre sie etwas boshaft nennen: Die „attracteurs“, die neue Sehenswürdigkeiten herstellen. Abgelegene Orte und Gegenstände von früher werden mit Geschichte und Geschichten aufgeladen, mit kultureller Bedeutung und erhöhtem Wiederverkaufswert. Denn von der touristischen Entwicklung einer Region profitieren in erster Linie, wie die beiden Autoren nüchtern vorrechnen, deren Grundstücksbesitzer (1).
Wie beim Land ist die Bedingung dafür der feste Glaube an eine jahrhundertealte Tradition, auch wenn sie neu erfunden ist. Im pittoresken Städtchen Laguiole im südfranzösischen Department Aveyron lässt sich besonders eindrucksvoll besichtigen, wie ein Ort in der Provinz nachträglich mit einer besonders wirkungsvollen Vergangenheit nachgerüstet werden kann. Die Restauration alter Häuser, um ihr Bruchsteinmauerwerk sichtbar werden zu lassen, gehört ebenso dazu wie jährlich wiederholte „traditionelle“ Feste (im Jahr 2000 zum ersten Mal abgehalten, aber altehrwürdig, „ancestrale“), Luxusgastronomie (ein Restaurant mit drei Michelin-Sternen) und ein neu eingerichteter Naturpark. Den Namen des Ortes kennen Sie aber vermutlich anderswoher. Die Messerherstellung in Laguiole, die 1896 als unbedeutend und klein beschrieben wurde und spätestens in den 1920er Jahren aufgehört hatte zu existieren, wurde in den 1980ern als „handwerkliche“ Herstellung neu gestartet, mit der Produktion teurer Sammlerstücke und erfolgreicher Selbstmusealisierung: Die beiden lokalen Produktionsfirmen der Taschenmesser werden jährlich von mehr als einer Viertelmillion Besuchern besichtigt. Die heute dort hergestellten Messer haben mit denen, die im 19. Jahrhundert als typisch für die Region beschrieben wurden, überhaupt nichts gemeinsam. Das Horn, aus dem ihre Griffe gefertigt werden, kommt aus Afrika und Südostasien, der Stahl aus Schweden. Und die modernen Schnellstraßen, auf denen man diese Idylle erreicht, wurden von Arbeitsmigranten aus Nordafrika gebaut (2).
Die Berufung auf lokale kulturelle Tradition schließt selbstverständlich den Wunsch ein, von der wirklichen (und meist gar nicht pittoresken) Vergangenheit nichts wissen zu wollen. Es ist nicht allzu kompliziert, deutsche Gegenstücke für solche Inszenierungen lokaler ländlicher Idyllen ausfindig zu machen. Wo fahren denn Sie gerne hin für ein verlängertes Wochenende im Grünen, Holsteinische Schweiz, Spreewald, Allgäu, oder lieber in die Reiche-Rentner-Freigehege in Oberbayern und am Bodensee?
Wer als Besucher auftreten und authentische lokale Kultur von früher konsumieren kann, hat nichts mit der eigenen Herkunft zu tun. Es ist eine Frage der Reisekasse. Die Inszenierungen vom heilen Landleben in Ferienhäusern und Wellnesshotels sind tatsächlich historisch. Es sind die modernen Äquivalente zu den Schäferidyllen der Vormoderne, in denen Dichter und Theaterautoren das Leben der arbeitenden Landbevölkerung jahrhundertelang in verkitschten erotisierten Stereotypen dargestellt haben – nicht obwohl, sondern weil sie sehr genau wussten, dass Bauern und Hirten unter ganz anderen Bedingungen lebten.
Denn auch das zeigt der Gebrauch des Begriffs vom Land: So schnell wird man die Vergangenheit nicht los. Der Traum von der Ständegesellschaft spukt weiterhin durch die touristischen Bilderbögen vom Leben auf dem Land, ebenso wie sein romantisches Gegenstück: Die Vision, sich selber in eine belesenere und kultiviertere Version jenes kernigen Landbewohners, jener entzückenden Landfrau zu verwandeln, die man am Ziel der eigenen Sehnsucht vermutet. Beide beruhen darauf, dass die Leute, die auf dem Land wohnen, sehr viel weniger Geld verdienen als diejenigen, die es aus der Stadt dort hinzieht. Es ist diese Differenz, die alle städtischen Besucher wie durch Zauberhand in vergleichsweise reiche Leute verwandelt, wenn nicht sogar in die Nachfolger jener Adeligen von früher, die jetzt eine geträumte Vergangenheit ihrer Wahl besichtigen und bewohnen können. Und die Anwohner in ihr Dienstpersonal verwandeln, wenigstens ein bisschen.
Sensible Kulturanalytiker wie die Sex Pistols haben das schon 1976 in Holiday in the Sun auf den Begriff gebracht: „I wanna see some of history / now that I got a reason out of economy.“ Die nächste Zeile, „cheap holidays in other people's misery“, mag ein bisschen arg zugespitzt sein, wenn es um die Rhön oder die Uckermark geht, aber so ganz freiwillig ist das Landleben für die Landbewohner nicht. Seine Wahrnehmung und Aneignung durch die Städter beruht auf handfester Ungleichheit in Sachen finanzielle Möglichkeiten – gewöhnlich in Idylle verpackt. Denn natürlich mögen es gutverdienende Besucher, wenn die Antiquitäten, die rotwangigen Äpfel und die Stundenlöhne für Handwerker schön billig sind. Tourismus ist als Phänomen davon bestimmt, was er ausschließt: bezahlte regelmäßige Arbeit. Überall dort, wo das Schöne von früher besonders gut erhalten ist, sind gut bezahlte und hoch qualifizierte Jobs extreme Mangelware. Deswegen ziehen sie ja in die Städte, all die Mobilen und Ehrgeizigen, die zwischen Kühen, Obstbäumen und Naturschutzgebieten aufgewachsen sind.
Vermutlich ist es an der Zeit, sich von der Vorstellung vom Land als kultureller Wiedergutmachungszone und historischer Beruhigungstablette zu verabschieden. Der Soziologe Richard Florida, von dessen „creative class“ zu Beginn die Rede war, hat 2017 ein neues Buch herausgebracht: The New Urban Crisis. Die großen Städte als kulturelle Wirtschaftsmotoren würden von ihrem eigenen Erfolg bedroht, schreibt er, der extreme soziale Ungleichgewichte und unkontrollierbare Immobilienblasen produziere. Und davor soll uns das Land als Idylle von früher beschützen, entschädigen, trösten? Das wird nicht funktionieren.
Wenn das Land – von wohlhabenden Stadtbewohnern, versteht sich – zum vermeintlichen Hort der Tradition und zum Reservoir für das Schöne von Früher gemacht wird, bekommen seine Bewohner keine Chance, dort selber etwas Neues anzufangen. Wer die Bewahrung und Rettung des „Traditionellen“ über alles stellt, verwandelt die Leute, die dort leben, in abhängiges Personal fürs Pittoreske – in Parkwächter und Putzfrauen, Museumsangestellte und Gartenzwerge.
Offenbar halten wir es schlecht aus, dass die Vergangenheit ein für immer unbetretbares Land ist, unwiderruflich verschwunden, futsch. Souveräner wäre es, das Vergangen-Sein der Vergangenheit zu akzeptieren, die Verluste inbegriffen. Und nicht mehr nach Antiquitäten zu suchen. Sondern nach den Freiräumen und Chancen zu fragen, die sich aus dem Verschwinden des Alten ergeben, also nach dem Platz für das Neue – gerade am Arsch der Welt.
1) Luc Boltanksi und Arnaud Esquerre: Enrichissement. Une critique de la marchandise, Paris 2017, S. 103, 76, 91.
2) Ebd. S. 425 ff. und 449.