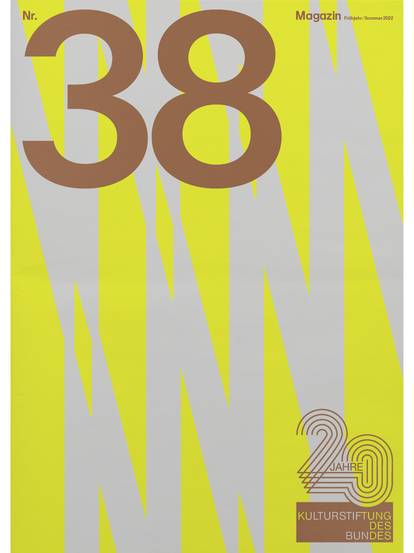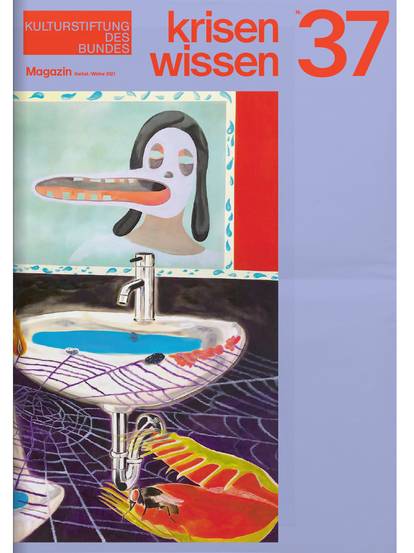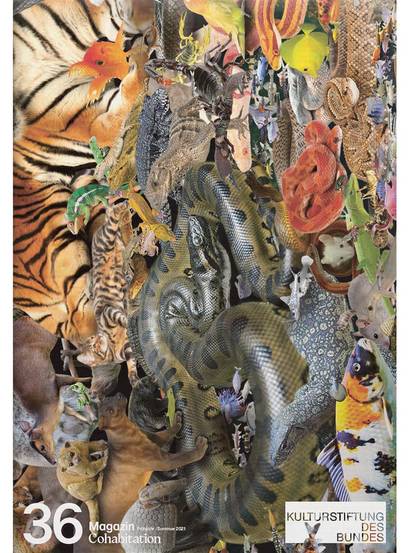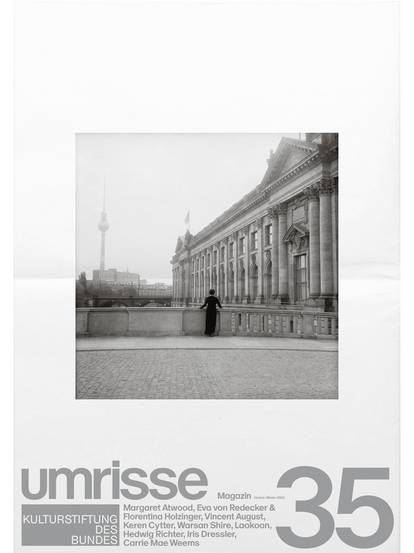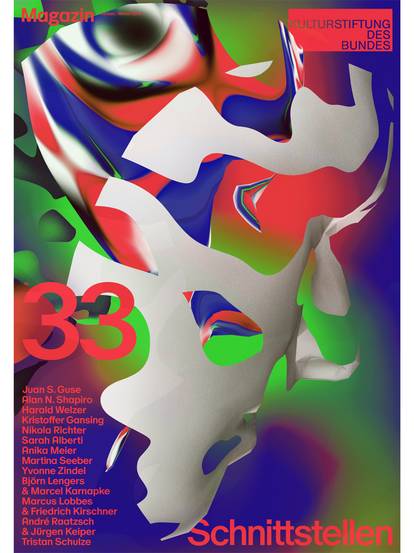Es sieht nach einer Szene aus einem dieser bösen Träume aus: Der Künstler Andy Picci, ganz in Schwarz gekleidet, befindet sich in einem strahlend weißen Raum. Er sitzt da, schaut sich um, macht sich mit seiner Lage vertraut. Verhalten ruft er in den Raum: „Jemand da?“ Die Antwort bleibt aus. Er legt sich hin, wartet, er scheint im weißen Raum zu schweben. Irgendwann wird er nervös, weil niemand kommt, weil ihm niemand antwortet. Er steht auf, rennt herum, schnappt nach Luft. Verzweifelt sinkt er zu Boden. „Bitte!“, immer wieder ruft er, „Bitte, lasst mich raus!“ Immer noch keine Antwort. Ende.
„Let me out“, also „Lasst mich raus“ auf Deutsch, ist auch der Titel seines knapp 8-minütigen Videos. Wenn man weiß, dass der französische Künstler Picci sich in seinem Werk mit dem Einfluss der Digitalisierung auf die Gesellschaft befasst, wird schnell deutlich, wofür die weiße Zelle steht. Smartphones und soziale Medien lösen erst ein Gefühl der Neugierde aus, man sieht sich um, probiert aus, fühlt sich unbeobachtet. Es folgt die Verunsicherung über das, was da vor sich geht. Likes, Follower, Aufmerksamkeit, Bestätigung. Was das mit einem macht: Selbstdarstellungssucht, Abhängigkeit.
Die Ökonomin Shoshana Zuboff fasst die Entwicklungen im digitalen Zeitalter mit dem Begriff des Überwachungskapitalismus zusammen. Sie schreibt in ihrem Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus: „Digitales Verbundensein ist heute ein Mittel zu anderer Leute geschäftlichen Zielen. Im Grunde seines Wesens ist der Überwachungskapitalismus parasitär und selbstreferenziell. (...) Anstatt von Arbeit nährt der Überwachungskapitalismus sich von jeder Art menschlicher Erfahrung.“
Menschen teilen Erfahrungen in den sozialen Medien, sie scheinen heute jede Minute ihres Alltags gewissenhaft vom ersten Augenaufschlag bis zum letzten Tanz in der Disco zu dokumentieren und zu teilen. Nicht selten wird ein Tag so geplant, dass er maximal „instagrammable“ ist, also das perfekte Bild vom perfekten Leben den Freunden und Followern vermittelt. Während sich einst darüber beschwert wurde, dass Fotos von Touristen unoriginell sind und ein Foto aussieht wie das andere (vom Eiffelturm, vom Schiefen Turm von Pisa etc.), trifft das heute auf Fotos in den sozialen Medien allgemein zu. Was einst für Urlaubsfotos galt, trifft heute auf jede Sekunde des Tages zu: „I was there, I did that.“ Ich war im Bett, ich bin aufgewacht, ich habe Kaffee getrunken. Wenn man also kunsthistorische Fragestellungen an Bilder richtet, die in den sozialen Medien geteilt werden, kommt man damit nicht sehr weit. Dann ignoriert man, dass in den sozialen Medien Fotos nicht als Objekte, die für sich stehen sollen, geteilt werden, sondern als Erfahrungen. „Das Zentrum der konzeptuellen Gravitation für die Beschreibung, wie Menschen heute mit Bildern kommunizieren, sollte weniger kunsthistorisch als sozialtheoretisch sein“, so Nathan Jurgensons Schlussfolgerung in seinem Buch The Social Photo: On Photography and Social Media. Mit Fotografie will „social photography“ überhaupt nicht konkurrieren, so der Ausgangspunkt von Jurgenson. Das ist das große Missverständnis.
Missverständnisse gibt es viele, wenn es um soziale Medien geht. Das besonders, wenn die Kunst ins Spiel kommt, denn die soll doch bitte nur dort stattfinden, wo wir es gewohnt sind: in Galerien und Museen, auf Biennalen und Festivals. Die Kunstkritikerin Swantje Karich beispielsweise schrieb in der WELT: „Das Schöne an Instagram ist doch die Fake-Unschuld des ‚Alle tun ja nur so, als wäre es Kunst‘.“ Aber wer tut denn nur so? Die einen kommunizieren, die anderen machen Kunst oder kommunizieren über ihre Kunst. Es folgt ein kleines Gedankenexperiment von Karich: Was wäre, wenn wir alle anfangen würden, Instagram mit Kunst zu verwechseln? Ihre Antwort: „Alle würden sich Künstler nennen und das Internet ausdrucken, wie damals die ersten Blogger, die immer auf die Wirklichkeit schimpften und doch anfingen, Bücher über Bücher zu publizieren. Dabei ist doch das Schöne an Instagram die Lautlosigkeit, mit der man es wieder vergisst.“ Das Schöne an Instagram ist die Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten: Foodblogger beispielsweise zeigen Food, Fashionblogger Kleidung, Travelblogger Reisen, Fitnessblogger Muskeln, Buchblogger Bücher und Künstler Kunst.
Künstler derweil sind genervt von der Kritik, Kunst sei auf der Plattform nicht möglich. Und wenn dann doch einmal in Betracht gezogen wird, dass es sich um Kunst handeln könnte, fällt meist die Bezeichnung Instagram-Künstler oder Instagram-Künstlerin. Ein Schriftsteller, beispielsweise Clemens Setz oder Saša Stanišić, der Twitter vielleicht sogar für das Teilen von Prosa-Miniaturen nutzt, wird ja auch nicht Twitter- Autor genannt. Amalia Ulman übrigens wird das erste Instagram-Meisterwerk zugeschrieben. Im sozialen Netzwerk werden die Schokoladenseiten des eigenen Lebens geteilt. Das sind Smoothies und Avocado-Toast, die Stunden im Fitnessstudio, die gute Figur vor dem Spiegel. Als Ulman genau diese Stereotype im Rahmen ihrer fünfmonatigen Performance im Jahr 2014 nachstellte und als authentisch präsentierte, war Instagram nicht mehr ganz neu. Aber eben noch nicht so weit, dass zahlreiche junge Frauen zum Teil mit Millionen von Followern Produkte von Unternehmen bewerben. Online sind wir alle Lügner, wir performen Perfektion und Erfolg. Und Amalia Ulman, die Künstlerin, performte mit, und zwar genau das, was sie zuvor in den sozialen Medien als weibliche Stereotype ausgemacht hatte: das Tumblr Girl, das sich bei Urban Outfitters einkleidet und ein bisschen langweilig ist. Das Hot Babe mit Sugar Daddy. Das Mädchen von Instagram, das auf Superfood und Yoga steht. Ulman konnte alle drei dieser Stereotypen nachleben, weil sie sich ein Narrativ für ihre Persona überlegt hatte mit Träumen und Wünschen, Erfolgen und Abstürzen und einem Happy End. Amalia Ulman wird folglich auch nachgesagt, eine Instagram-Künstlerin zu sein. Ihre Antwort (Monopol 3/2018): „Ich bin eine Künstlerin. Ich nutze Instagram, weil es die gängigste Plattform ist. Wenn ich früher dran gewesen wäre, hätte ich vielleicht einen Chatroom genutzt. Es ist einfach Netzkunst, was ich mache. Und Performance. Und Fotografie. Es ist Kunst.“
Schon im Jahr 2016 hat die Amerikanerin Natasha Stagg in ihrem Roman Survey über den schnellen Weg zu Ruhm und Erfolg in den sozialen Medien geschrieben. Influencer und Self-Branding sind heute in aller Munde. Auf Instagram, für alle Augen sichtbar, rücken Teenager sich in das beste Licht, sie möchten #instafame, sie sehen sich selbst als Marke, die es gilt aufzubauen und zu promoten. In Staggs Roman hat Lucinda, eine aufstrebende Influencerin, einen siebenseitigen Essay über die Zukunft des Ruhms geschrieben. Darin schreibt sie: „In the future, no one will want to be famous, in the way that no one wants to be exploited. We will all aspire to be less and less known as we grow up.“ In der Zukunft, so glaubt sie, will niemand mehr berühmt sein.
Als Instagram im Jahr 2010 neu war, wusste niemand so recht, wohin es mit diesem sozialen Netzwerk gehen wird, das offenbar erst einmal dazu da war, Fotos einen Vintage-Look zu verpassen. Mit polaroidigen Aufnahmen konnte man Freunde wissen lassen, wie schön es gerade hier und da ist. Bald war klar, dass man mit den richtigen Inhalten Follower und Likes sammeln konnte — das war erst einmal angenehm fürs Gehirn. Bald war auch klar, wenn man alles richtigmacht, lässt sich mit Followern und Likes Geld verdienen.
Kürzlich meldete The Atlantic, dass jetzt selbst Influencer keine Lust mehr auf die typische Instagram-Ästhetik haben und es authentisch wollen. The Instagram Aesthetic is Over, lautete der Titel. Influencer fotografieren sich vor bunten Wänden oder in beliebigen Pop-up Museen, Influencer schleppen schwere Kameras an den Strand, Influencer machen irgendwas mit langen Fingernägeln und Kaffeetassen. Das alles will niemand mehr sehen. Das haben Menschen bestätigt, die in Influencer-Marketing-Agenturen arbeiten. Ein paar Tage später legte Quartzy nach, unter dem Titel The Age of the Influencer has Peaked. It’s Time for the Slacker to Rise. Selbst Postings von Privatpersonen auf Instagram würden sich lesen wie Mini- Pressestatements. Man sehne sich jetzt also zurück in die 90er. Damals habe niemand seinen Lifestyle monetarisiert oder sei mit Brands ins Bett gestiegen. Und heute? „Nothing is sacred, art has been replaced by content, and everything is for sale“, steht beispielsweise im Text. Irgendwann müsse es auch mal wieder gut sein mit der Selbstoptimierung, irgendwann würde es den Menschen wieder unangenehm sein, sich mit Unternehmen einzulassen. Es ist also eingetreten, was Staggs fiktive Influencerin schon 2016 prophezeit hat.
Künstler sind nah dran am Zeitgeist auf Instagram, ihre Konzepte und Kritik ändern sich so schnell wie die gesellschaftlichen Entwicklungen, die sie reflektieren. Der deutsche Konzeptkünstler Andy Kassier beispielsweise spiegelt männliche Rollenklischees auf Instagram. Seine gleichnamige Kunstfigur ist reich und erfolgreich und immer da, wo die Sonne scheint und es Geld regnet. Kassiers Motto: „Success is just a smile away.“ Wer nicht weiß, dass es sich um eine Langzeitperformance handelt, der glaubt womöglich, Kassier sei noch so einer, der nicht oft genug Motivationssprüche raushauen und in den Urlaub fliegen kann, einfach, weil er es kann. Der belgische Künstler Tom Galle kritisiert wie Kassier selbstironisch das digitale Zeitalter. Er zerstört scheinbar mutwillig Apple-Geräte oder überdreht deren Nutzung: MacBooks verwendet er mit Selfie-Stick, aus iPhone-Kartons werden Sandalen. Aus Logos großer Unternehmen wie Facebook, Mercedes und Nike hat er Waffen gemacht, mit denen er wie für ein glossy Werbefoto posierte. Galle übt Kapitalismuskritik auf eben der Plattform, die der Kapitalismus trägt. Mit seiner neuen Arbeit auf Instagram reagiert er auf die erbitterten Diskussionen um den Klimawandel. Texttafeln mit vermeintlich „deepen“ Motivationssprüchen sind likestarker Content auf Instagram. Galle setzt auf die Text- Bild-Schere. Den Spruch „Difficult roads often lead to beautiful destinations“ unterlegt er beispielsweise mit einem Foto von einem Waldbrand.
Unter dem Pseudonym Ona zeigt die amerikanische Künstlerin Leah Schrager auf Instagram, wie Intimität in Zeiten sozialer Medien zur Ware wird, wie sich weibliche Sexualität verändert, wie sich Frauen erniedrigen, um auf Männer anziehend zu wirken. Ona hat mittlerweile über drei Millionen Follower, der Account wächst jeden Tag um 10.000 Follower, sie kann davon leben. Die Kunstwelt aber akzeptiert sie nicht, weil sie die Grenzen zwischen Kunst und Pornografie verschwimmen lässt. Von ihrem Dasein als sexpositive Performancekünstlerin hatte sie deshalb letztes Jahr genug. Auf ihrem Account @leahschrager läuft seit Oktober 2018 eine Performance: Schrager hat die Unterstützung eines männlichen Förderers angenommen, der innerhalb eines Jahres eine Million Dollar in ihre Kunst investieren möchte. Sie hat sich in die Hände eines Mannes begeben, der ihr zu Erfolg in der Kunstwelt verhelfen soll, indem er entscheidet, welche Bilder angemessen sind. Wie Staggs fiktiver Influencerin reichen Schrager #instafame und Follower nicht mehr, sie möchte Anerkennung und Erfolg als Künstlerin außerhalb der sozialen Medien.
Künstlerinnen sind wie Influencer weit davon entfernt, den sozialen Medien den Rücken zu kehren. Sie sind und bleiben dort, wo ihr Publikum ist. Einst waren es Websites, dann Blogs, Tumblr wurde von Instagram abgelöst. Eine neue Plattform ist noch nicht in Sicht, aber mit Augmented Reality eine neue Technologie, die auch Instagram über die Plattform Spark AR integriert hat. Künstler wie Andy Picci reagieren derweil schon auf die neue Welle der Selbstbespiegelung, die AR-Gesichtsfilter möglich machen. Selbst Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz zeigen sich auf Instagram mit wackelnden Hundeohren und feuchter Schnauze. Piccis Filter kommentieren den Wunsch der Vielen, unbedingt gesehen werden zu wollen, seine Filter heißen Self-Centred, Fame und Behind the Mask. Da fliegt beispielsweise ein Smartphone vor dem eigenen Gesicht herum, auf dem ein Sticker mit der Aufschrift klebt: „Social Media Seriously Harms Your Mental Health“.
„Bitte, lasst mich raus!“