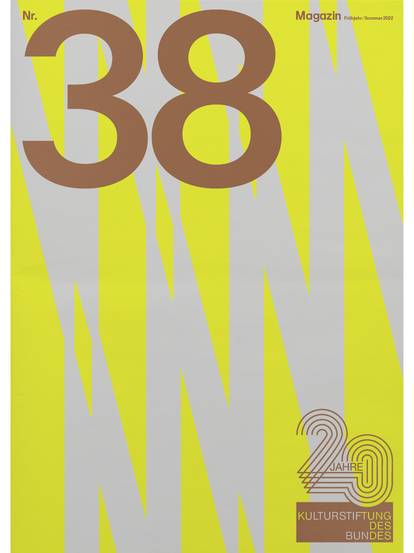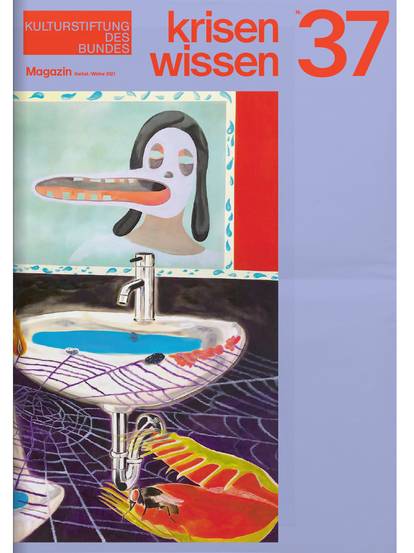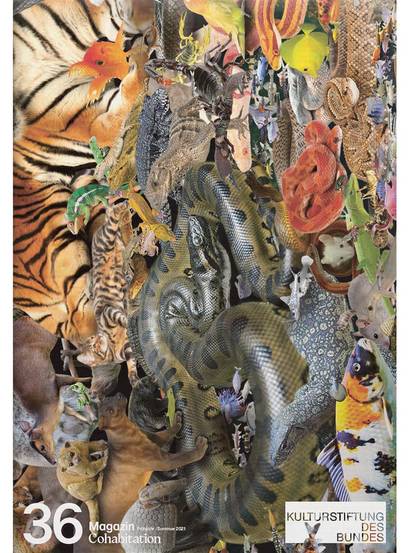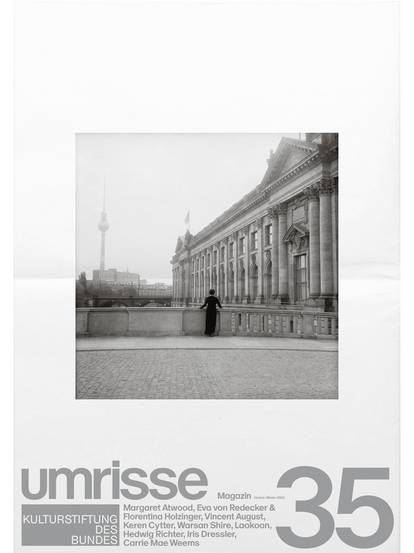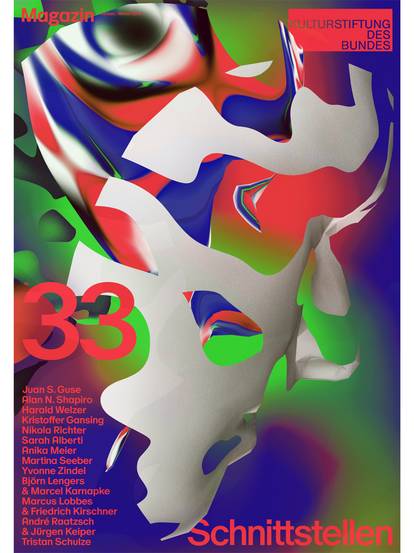Wie werden Sie dieses Heft lesen? Als Schrift gewordenes Echo aus einer anderen Zeit? Wir wissen es nicht. Unter dem Namen Coronakrise verspricht die Jetztzeit als historische Zäsur in die Geschichte einzugehen. Angesichts der anhaltenden Auswirkungen der Coronakrise und der Wahrscheinlichkeit weiterer Pandemien wird es eine Rückkehr zum Status quo ante ebenso wenig geben wie ein Weiterso. Nicht von ungefähr spüren Kulturschaffende und auch viele Kulturinstitutionen die Folgen des unumgänglichen social distancing als besonders schmerzhaft, als eine existenzielle Gefährdung unbekannten Ausmaßes.
Begreift man die Coronakrise als eine so gravierende Zäsur, dass sie die Geschichte in ein Vorher und ein Nachher einteilt, ist einer ihrer einschneidendsten kulturellen Effekte womöglich die Herausforderung an ein neues Verhältnis zur Dimension der Zeit. Man könnte von einem Perspektivwechsel mit erheblichen Folgen für die kulturelle Produktion sprechen: Das „Vorher“ war im Horizont von Digitalisierung und Globalisierung durch die Dominanz des Denkens in räumlichen Dimensionen geprägt. Der Fokus vieler Kulturschaffender und entsprechend auch der von Kulturförderern lag auf der Erweiterung von Raum und Radius kultureller Aktivitäten, auf dem forcierten internationalen und interkontinentalen Austausch, der Aneignung des digitalen Raums bis hin zur Forderung nach mehr Kultur „in der Fläche“.
Als würde die Dimension der Zeit auf ihre gesellschaftliche Rehabilitation pochen, meldet sie sich nun mit dem full stop im Gefolge des Coronavirus zurück — und zwar global. Die Coronakrise zwingt allen eine andere Zeitrechnung auf, die bisherige gesellschaftliche Sicherheiten und individuelle Gewohn- und Gewissheiten in Frage stellt. Wahrscheinlich erzeugt Corona sogar ein neues Zeitmaß, dessen Grundeinheit neuerdings „auf Sicht Fahren“ heißt. In die Sprache der Kultur übersetzt: Wir führen ein Leben auf Probe. Welche Herausforderungen das für den Kulturbetrieb darstellt, ist bisher erst schemenhaft zu erahnen. Das „Nachher“ wird durch die Einsicht geprägt sein, dass auch die Zeit — und nicht nur der Raum — Gestaltung erfordert. Die gerade für Kulturschaffende wichtige Ressource Planbarkeit ist jetzt schon für viele auf unabsehbare Zeit zu einem knappen Gut geworden, die Halbwertszeit von Ideen und Projekten im Horizont der unbestimmten Pandemie-Zeit kaum noch kalkulierbar, die Geltungsdauer von Vorhersagen auf Tage geschrumpft.
Die Produktion dieses Heftes ist unmittelbar von jener Zäsur betroffen: Innerhalb weniger Wochen erscheint vieles von dem, was wir vor Ausbruch der Coronakrise beauftragt haben, als überholt, zumindest in seiner Aktualität und Dringlichkeit. Wenn es um das Überleben des Kulturbetriebs und die Existenzsicherung freischaffender Künstlerinnen geht, darf man dann noch Fragen nachgehen, die vor der Coronakrise vordringlich erschienen? So weitermachen wie ursprünglich geplant? Oder verwerfen und ein Heft über die coronabedingten Kalamitäten der Kulturschaffenden nachproduzieren? Mit welcher Halbwertszeit?
Wir haben uns für die Beibehaltung des Themenschwerpunkts „Dilemmata“ entschieden. Es erscheint uns wie die Signatur der Gegenwart. Ganz gleich, um welchen gesellschaftlichen Bereich es geht, überall ist festzustellen, dass Entscheidungen schwieriger geworden sind, dass sie in subjektiv empfundene Dilemmata führen. Dass sich Gründe „dafür“ mit denen „dagegen“ die Waagschale halten, unzweifelhafte Lösungen und einfache Auswege nicht in Sicht sind. Sich in einem Dilemma wähnen, bedeutet in heutiger Zeit nicht mehr und nicht weniger als ein „wir wissen (noch) nicht, wo es langgehen soll“.
Vielleicht ist es aber auch ganz anders: Vielleicht ist die Wahrnehmung eines Dilemmas in Wahrheit eine Konstruktion, ein Schutzschild, eine Entschuldigung für Bequemlichkeiten, für die Vermeidung der Unannehmlichkeiten zeitraubenden Umdenkens. Darauf macht Till Briegleb in seinem Artikel „Konsequenzlähmung“angelegentlich seiner Überlegungen zum Dilemma zwischen dem Postulat internationalen kulturellen Austausches und den Auflagen des Klimaschutzes aufmerksam.
Das Heft beginnt mit dem im westlichen Diskurs womöglich größtmöglichen Dilemma: Ist die Rettung des Planeten nur um den Preis der Einschränkung demokratisch verbriefter sozialer Teilhabe möglich, haben wir den Soziologen Stephan Lessenich gefragt. Er mutet einem mit seiner Analyse, die Demokratie sei ökologisch nicht unschuldig, einiges zu. Der Theatermacher Milo Rau hat sich damit einen Namen gemacht, auf der Bühne und in Filmen sein Publikum mit kapitalistisch und kriegerisch erzeugtem Elend zu verstören, den humanitären Katastrophen im Kongo, in Mossul und aktuell mit der verzweifelten Lage der Landlosen im Amazonas. Wir haben ihn um einen Beitrag zum Dilemma zwischen Ethik und Ästhetik gebeten: Sind es mehr als die laut Andy Warhol berühmten 15 Minuten, in denen jeder ein Künstler sein darf, wenn die Entrechteten in einem Theaterstück tragende Rollen bekommen? Milo Rau spricht bezeichnenderweise nicht von einem Dilemma, sondern von gesellschaftlichen Widersprüchen, Seite 4 die sich in der Kunst notwendig widerspiegeln. María Berríos, eine der Kuratorinnen der 11. Berlin Biennale, und die in Lateinamerika prominente feministische Anthropologin Rita Segato haben wir gefragt, wie sie das Dilemma einschätzen, wenn die postkoloniale Strategie zur Überwindung eurozentristischer Perspektiven darin besteht, „anderen eine Stimme zu geben“. Sie halten auf unterschiedliche Art dagegen. „Nehmen statt geben“ ist das Motto von Berríos. Indigene Kulturgüter vor dem neokolonialen Zugriff schützen, den Europäern die Illusion rauben, sie könnten ihrer in ihrer ursprünglichen Bedeutung jemals habhaft werden, damit trotzt Segato der freundlichen Übernahme.
Nicht von ungefähr haben wir den Einleger mit Bildern des brasilianischen Ausnahmekünstlers Leonilson zwischen diese beiden Beiträge aus dem lateinamerikanischen Kontext eingefügt. In seiner Auseinandersetzung mit identitätspolitischen Fragen sowie dem Zusammenhang von Körper und Politik war der 1993 verstorbene Künstler Wegbereiter für eine Kunst, die den gesellschaftspolitischen Zurichtungen der brasilianischen Militärdiktatur auf unbeugsame und höchst fantasievolle Weise Widerstand leistete. Sein vielschichtiges Schaffen soll erstmals in Europa in einer umfassenden Werkschau in den Berliner KW Institute for Contemporary Art in diesem Herbst gezeigt werden. Die Kunsthistorikerin Cathrin Mayer stellt den hierzulande noch weitgehend unbekannten Künstler auf der Rückseite des Einlegers vor. Im unabsehbaren Horizont der Coronakrise denkt man unwillkürlich an Bertolt Brechts Verse aus der Dreigroschenoper: „Ja, mach nur einen Plan / sei nur ein großes Licht / und mach dann noch 'nen zweiten Plan / gehn tun sie beide nicht.“ Mögen die Kuratoren durch eine kluge Lösung Brechts düstere Prognose widerlegen!
Das Dilemma der Repräsentation behandelt Alexander Koch am Beispiel der Neuen Auftraggeber. Eine vergleichsweise kleine Gruppe von zivilgesellschaftlich engagierten Menschen sorgt für Veränderungen in ihrem sozialen Umfeld, von denen alle betroffen sind. Woher nimmt sie, wie organisiert sie ihre Legitimation? Und Lyn Gardner stellt die nicht nur in der Theaterszene virulente Frage, wie man dem circulus vitiosus entgehen kann, dass bewusstseinsverändernde Kunst vielfach nur das Publikum anspricht, das ohnehin schon das „richtige“ Bewusstsein hat.
Der literarische Beitrag dieses Heftes von Senthuran Varatharajah ist dem grundlegenden Dilemma, dem existentiellen Drama der Liebe gewidmet. In der Sprache der Liebe wird es in Metaphern des Einverleibens manifest. Der Wunsch nach maximaler Nähe, dem identischen Aufgehobensein im anderen, schlägt um in kannibalistische Vernichtung.
Was ist, wenn Sie dieses Heft in den Händen halten? Wir wissen es nicht. Wird dieses Editorial von den Ereignissen und Entwicklungen überholt worden sein? Das alte Denken manifestiert sich offensichtlich im Plusquamperfekt. Was wir brauchen ist eine Sprache im Tempus der Zukunft. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten.