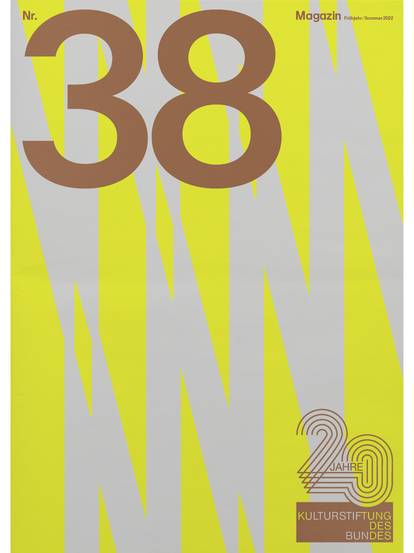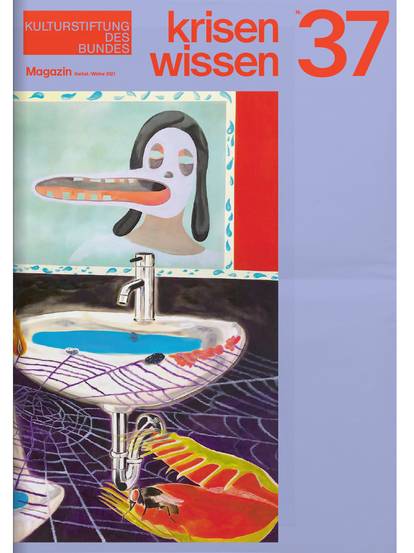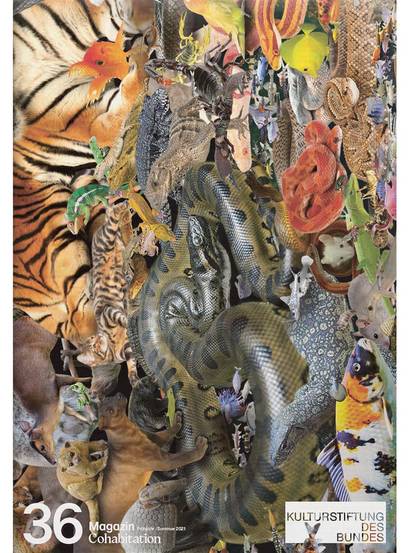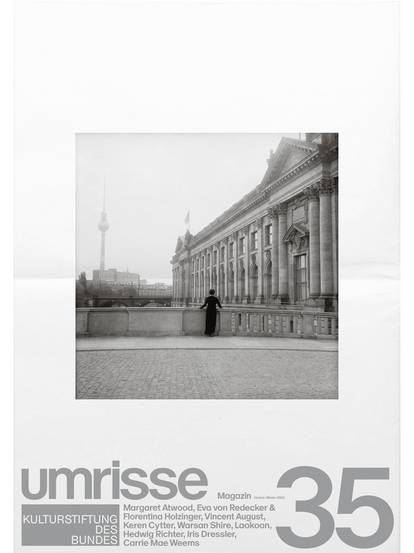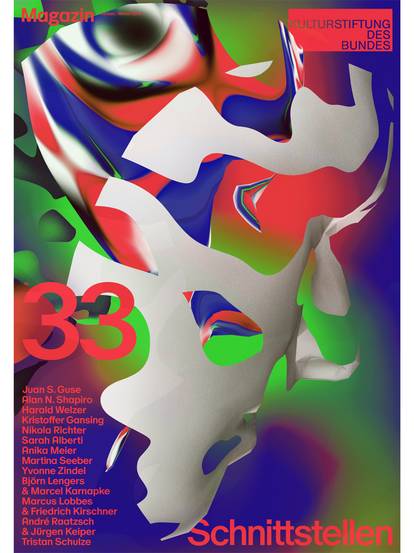I.
Als Joe Biden am 7. November 2020 gemeinsam mit seiner designierten Vizepräsidentin Kamala Harris auf einer Bühne in Wilmington, Delaware, seinen Sieg bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl verkündete, war rechts und links von ihm auf gigantischen Videoleinwänden zu lesen: „The people have chosen empathy“. Ein treffender Slogan für einen Wahlgewinner, dessen Kampagne die Einfühlsamkeit des Kandidaten zu seinem Markenkern gemacht hatte: Biden, der Mann, der durch den frühzeitigen Tod von Frau und Kindern selbst härteste Schicksalsschläge erdulden musste und der deshalb das Leid amerikanischer Familien nachfühlen kann, die durch die Pandemie Angehörige verloren haben. Biden, der Mann, der sich nie geschämt hat, über seinen Schmerz und seine Trauer öffentlich zu sprechen, und deshalb glaubwürdig Mitgefühl und Trost spenden kann.
Mit diesem Image trat Biden gegen Donald Trump an, den der US-amerikanische Publizist und frühere Minister Robert Reich einmal als „the world’s least empathic man“ geschmäht hatte und dessen fanatische Anhängerschaft bezeichnenderweise gerne T-Shirts mit dem Slogan „Fuck your feelings!“ trägt. Trump, der sich während seiner Amtszeit wieder und wieder als unfähig erwies, ein Mindestmaß an Anteilnahme gegenüber den Opfern von Erdbeben oder Amokläufen an den Tag zu legen oder wenigstens zu simulieren. Trump, für den jede öffentliche Gefühlsregung ein Zeichen unmännlicher Schwäche und Mitgefühl schlichte Blödigkeit ist. Das Ergebnis ist bekannt: Biden gewann, Trump verlor. Einfühlsamkeit siegte über Herzlosigkeit.
II.
Die Geschichte von Joe Bidens Sieg scheint die These von der Empathie als Macht des Guten zu bestätigen. Sie steht im Zentrum eines Diskurses, der – im Kielwasser der Theorie der Spiegelneuronen – ungefähr zur Jahrtausendwende Fahrt aufnahm und die Empathie zur Urkraft des Sozialen ausrief, von Frans de Waals „The Age of Empathy“ und Jeremy Rifkins „The Empathic Civilization“ bis zu jüngeren populären Titeln wie „Empathie. Warum einfühlsame Menschen gesund und glücklich sind“ oder „Homo Empathicus“.
Es ist keineswegs neu, dass der Empathie diese Rolle angetragen wird. Vergleichbares geschah schon im 18. Jahrhundert, als David Hume, Adam Smith und Jean-Jacques Rousseau das natürliche Mitgefühl zur Grundlage der Moral erklärten. An der Wende zum 20. Jahrhundert – unter anderem bei Theodor Lipps, Max Scheler und Edith Stein – avancierte „Einfühlung“ zum Grundbegriff einer Theorie intersubjektiven Verstehens und sozialen Handelns. Beide Male waren es Vereinzelungs- und Entfremdungserfahrungen der sich beschleunigenden Moderne, welche die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Gesellschaft überhaupt aufwarfen. Beim gegenwärtigen Empathie-Diskurs verhält es sich nicht anders: Er ist im Zusammenhang mit der zunehmenden Fragmentierung und Virtualisierung des Sozialen im Umfeld der neuen digitalen Medien zu lesen. In kaum einem Feld gesellschaftlicher Praxis wird die zerstörerische Wirkung mangelnder Empathie stärker empfunden und häufiger beklagt als im Reich der „Shitstorms“, des „Trolling“ und der anonymen Hassrede.
III.
Dass Empathie eine Macht des Guten sein kann, ist empirisch gut belegt. Skeptiker haben jedoch stets auch auf ihre dunkle Seite hingewiesen. Empathie kann dazu verführen, der emotionalen Erschütterung durch den konkreten Einzelfall den Vorzug vor abstrakteren ethischen Gesichtspunkten wie Gerechtigkeit und Fairness zu geben. Und nicht immer hilft Empathie dabei, Gräben zu überwinden. Die psychologische Forschung zeigt, dass wir deutlich mehr Mitgefühl mit dem Schicksal von Menschen zeigen, die uns ähnlich sind oder denen wir uns nahe fühlen. In einer solchen empathischen Verbundenheit fühlen wir aber auch die negativen Affekte dieser Menschen mit: ihren Zorn, ihre Furcht, ihre Aggressivität gegenüber anderen, von denen sie sich bedroht fühlen. Die Empathie lässt uns Partei ergreifen – für die unseren, gegen die anderen – mit dem Ergebnis, dass uns das Empathisieren mit jenen anderen immer schwerer fällt.
IV.
Was ist also von Empathie zu erwarten – und was nicht? Um hier eine deutlichere Vorstellung zu gewinnen, wäre zunächst zu klären, was unter „Empathie“ zu verstehen ist. Ein Blick in die reichhaltige Literatur zeigt, wie unterschiedlich dieser Begriff verwendet wird. Die folgende Skizze mag als Minimalkonzeption dienen: Empathie oder Einfühlungsvermögen ist die Fähigkeit, auf die bewusst oder unbewusst zum Ausdruck gebrachten affektiven Zustände einer anderen Person mit der Einnahme einer Haltung zu reagieren, die selbst eine affektive Komponente, also eine Gefühlsqualität aufweist. Diese Reaktion kann ebenfalls bewusst oder unbewusst sein. Das Spektrum reicht von unwillkürlichen körperlichen Regungen bis zu absichtlichen, reflektierten Akten der Anteilnahme. Dass dabei immer eine eigene Gefühlsregung im Spiel sein muss, ist wichtig, um Empathie von der ausschließlich distanziert- intellektuellen (also „a-pathischen“) Beobachtung und Deutung des Verhaltens anderer zu unterscheiden.
Alles spricht dafür, dass die Fähigkeit zur Empathie in diesem Sinne eine natürliche Anlage des Menschen ist. Diese Anlage wird jedoch im Verlauf der menschlichen Sozialisation vielfach kulturell überformt. Amalgamiert mit perzeptiven und mit sprachlichen Fähigkeiten wird Einfühlung zu einer gezielt einsetzbaren sozialen Kunst, die sich verschiedener Techniken bedient. Unzählige Bestseller aus der Beratungs- und Managementliteratur machen sich anheischig, diese Techniken zu vermitteln und zu perfektionieren. Der letzte Schrei auf diesem Markt sind Empathietrainings durch Virtual-Reality-Simulationen, die etwa mit dem Versprechen auftreten, für die Kundinnen am eigenen (virtuellen) Leib erlebbar zu machen, wie es sich anfühlt, aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert zu werden.
V.
Hier wird deutlich, wieso Einfühlungsvermögen im erläuterten Sinne nicht schlechthin als Macht des Guten gelten kann. Empathie als Kunst oder Technik ist noch keine Tugend. Sie kann zu guten wie zu schlechten Zwecken eingesetzt werden. Erstens kann sich Empathie auf unangemessene Ziele richten. Diejenigen mit der größten Fähigkeit, unsere Empathie zu wecken und auf sich zu ziehen, sind nicht immer diejenigen, die berechtigten Anspruch auf sie erheben dürfen. Zweitens ist die hervorgerufene affektive Reaktion nicht notwendigerweise die sozial erwünschte. Leid erzeugt Mitleid. Aber nicht immer. Es kann auch Schadenfreude oder Genugtuung erzeugen. Im Sinne der skizzierten Minimalkonzeption muss das eine genauso als empathische Reaktion gelten wie das andere.
Dagegen ließe sich einwenden, das Lob der Empathie habe natürlich niemals der bloßen Technik des Sicheinfühlens, sondern stets der Tugend der Einfühlsamkeit gegolten, und in diesem Sinne sei Schadenfreude das genaue Gegenteil von Empathie. Erstaunlicherweise stößt aber sogar die Empathie als Einfühlsamkeit noch auf Vorbehalte, und dies häufig genau bei jenen, denen die Einfühlsamkeit „gilt“. Um das zu verstehen, müssen wir den Blick auf die sozialen Beziehungen lenken, in deren Rahmen Empathie verwirklicht werden kann. Meine These lautet, dass Empathie nur dann als soziale Tugend gelten kann, wenn diese Beziehungen eine bestimmte Form annehmen.
VI.
Um diese These zu begründen, greife ich im Folgenden in stark vereinfachter Weise auf Überlegungen Max Schelers zurück.
Betrachten wir zwei fundamental unterschiedliche Formen der Empathie am Beispiel zweier Fälle. Im ersten Fall teilen zwei Fühlende einen gemeinsamen Affekt, etwa einen tiefen Schmerz. Schelers viel zitiertes Beispiel beschwört das Bild zweier Eltern, die am Totenbett des geliebten Kindes trauern. Sie fühlen gemeinsam. Doch keines der Elternteile richtet dabei sein Gefühl auf die Gefühle des anderen. Beide sind sie in ihrem Schmerz ausschließlich auf das Kind gerichtet, das ihnen entrissen wurde. Sie teilen zu zweit dasselbe Gefühl, dessen plurales Subjekt sie sind. Wir können diese Form der Empathie „Miteinanderfühlen“ nennen.
Davon zu unterscheiden ist ein zweiter Fall, in dem zwei Subjekte je eigene, voneinander getrennte Gefühle empfinden, von denen jedoch das eine (das Mit-Gefühl) intentional auf das andere ausgerichtet ist. Hier ist also nicht der gemeinsame Verlust der Gegenstand eines geteilten affektiven Bewusstseins, sondern die Gefühle des einen Subjekts bilden den Gegenstand der Einfühlungsbemühungen des zweiten. Dies könnte die Einstellung einer Freundin des Elternpaares sein, die sich ihrem Schmerz empathisch nähert und dazu ihre Beobachtungsgabe, ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre Imagination einsetzt. „Ich weiß, was ihr durchmacht“, könnte sie sagen. Nennen wir diese Form der Empathie „Nachfühlen“.
VII.
Entscheidend ist nun, dass in dieser Beziehung des Nachfühlens das erste Subjekt nur als „Objekt“, als Gegenstand der Einfühlungsbemühungen des zweiten auftaucht. Es selbst ist an dem Prozess nicht beteiligt. In dieser Objektivierung des anderen aber liegt eine unvermeidliche Anmaßung, eine Aneignung, ja eine Usurpation seiner Subjektivität, die zum Gegenstand der Einfühlung wird, und zwar auch dann, wenn letztere mit uneingeschränkt rechtschaffenen und wohlwollenden Absichten erfolgt. Der andere wird nicht gefragt, ob er einverstanden ist mit dem Akt selbst oder mit seinen Resultaten. Darin liegt eine Entmündigung. Das ist der Grund dafür, warum ein Satz wie „Ich kann es dir nachfühlen“ aus dem Mund des richtigen Menschen Trost bedeuten kann, aus dem Mund des falschen Menschen jedoch als Zudringlichkeit, als Übergriffigkeit, möglicherweise sogar als Aggression erfahren wird, die Abscheu und das Gefühl der Verletzung erzeugt.
Mir scheint, dass dies häufig im Kontext gegenwärtiger Rassismusdebatten geschieht. Im Kampf gegen Rassismus knüpften sich von je her große Hoffnungen an den Begriff der Empathie. Gerade hier wird aber in jüngster Zeit immer lauter kritisiert, dass das tränenreich zur Schau gestellte privilegierte Nachfühlen des Leids der Opfer gelegentlich eher dem Zweck zu dienen scheint, sich selbst der eigenen moralischen Korrektheit zu versichern und so eine Mitverantwortung für das beklagte Leid abzuwehren. Sich gut fühlend darüber, wie schlecht man sich aufgrund des Leids anderer fühlt, überlässt man sich dem selbstzufriedenen Gefühl, den eigenen Beitrag zu einer besseren Welt bereits geleistet zu haben. Die Opfer aber beharren darauf, dass ihr Leid nicht in dieser unerbetenen Weise nachfühlend angeeignet werden kann und darf. Dies kommt in mehr oder weniger polemischen Zurückweisungen der aufgedrängten Nachfühlung zum Ausdruck: „Kein Nichtbetroffener darf sich einbilden, unser Leid nachfühlen zu können. Keine Nichtbetroffene darf sich anmaßen, darüber sprechen zu können. Nur wir können für uns sprechen. Nur wir dürfen Auskunft geben.“
VIII.
Die so entstehende Diskurslage wird auf der Gegenseite oft als aporetisch wahrgenommen, als ein „double bind“, das Hilflosigkeit hervorruft. Es macht den Anschein, als werde Empathie einerseits eingefordert, andererseits jedoch aggressiv zurückgewiesen.
Betrachtet man jedoch die Form der Beziehung, die sich hinter der scheinbaren Aporie verbirgt, so zeigt sich, wo der Ausweg zu finden ist: Gefordert wird eine Form der Empathie, die das Gegenüber nicht zum Objekt macht, sondern als Subjekt ernst nimmt, die sich nicht „auf“, sondern „an“ es richtet. Eine solche Form der Empathie ist keine einseitige Bemühung, sondern ein dialogischer Prozess, an dem beide Seiten interaktiv partizipieren. Das verteilt die Verantwortung für ihr Gelingen auf zwei Paar Schultern: Die eine Seite muss zulassen, dass man sich ihr überhaupt empathisch nähert. Mehr noch, sie muss die fast übermenschliche Zumutung auf sich nehmen, ihren Schmerz zu teilen, ihn nicht exklusiv als den ihren zu hüten und zu verteidigen, sondern sogar noch denen, die ihn verursacht haben, die Teilhabe daran anzubieten. Die andere Seite hingegen muss sich darauf einlassen, den Schmerz des Gegenübers als „ihren eigenen“ zu begreifen und anzunehmen. Zugleich muss sie dem Gegenüber vorbehaltlos das letzte Wort in der Frage zugestehen, ob es sich verstanden fühlt. Die Berechtigung zu der Aussage „Ich kann es euch nachfühlen“ hängt davon ab, ob diejenigen, an die sie adressiert ist, sie als berechtigt anerkennen.
IX.
Einfühlsamkeit, so meine ich also, ist eine Tugend nur dann, wenn sie sich im Rahmen einer „dialogischen Beziehung“ verwirklicht. In einem solchen einvernehmlichen Dialog müssen beide Seiten etwas von sich preisgeben und sich auf diese Weise verletzbar machen. Wer dialogische Einfühlsamkeit zeigt, nimmt diese Verletzlichkeit an. Das ist der Grund, weshalb der Hass toxischer Soziopathen vom Schlage Trumps durch nichts so angestachelt wird wie durch die öffentlich bekannte Verletzlichkeit der von ihnen so verachteten „liberal snowflakes“ und „bleeding hearts“: Diese führen ihnen vor Augen, wozu sie selbst nicht in der Lage sind. Zugleich lässt sich jetzt die Macht der Empathie besser verstehen. Es zeigt sich, dass diese weniger von der Einfühlung als solcher abhängt als vielmehr von der Form der Beziehung, in der sie verwirklicht wird. Ist diese Beziehung einseitig, bleibt die Empathie bloße Sozialtechnik. Ist sie jedoch dialogisch, so kann das zunächst einseitige Nachfühlen in ein geteiltes Miteinanderfühlen transformiert werden. So und nicht anders bringen wir die dunkle und die helle Seite der Empathie ins Gleichgewicht. So verstanden ist Empathie am Ende doch eine Macht des Guten. Gefordert wird eine Form der Empathie, die das Gegenüber nicht zum Objekt macht, sondern als Subjekt ernst nimmt.