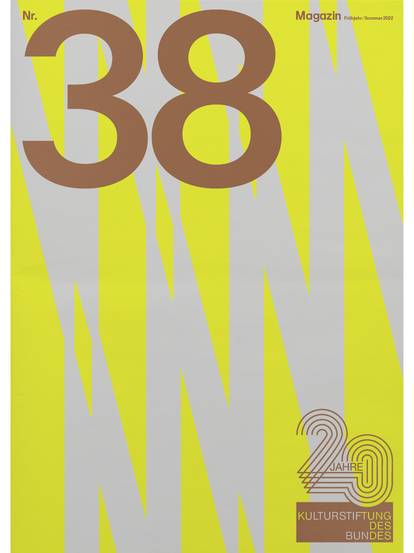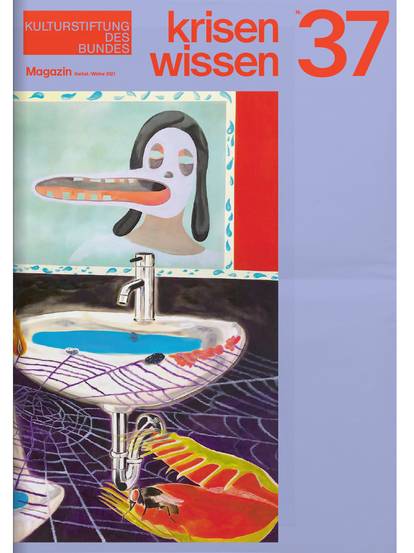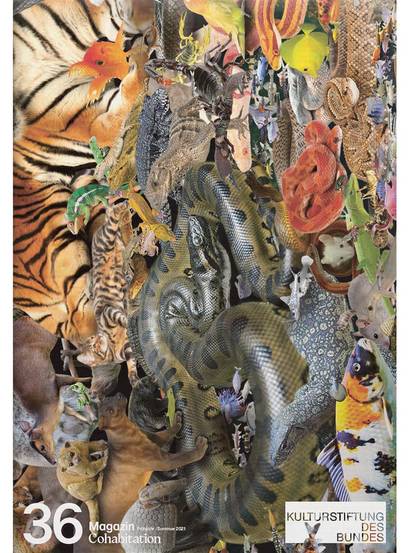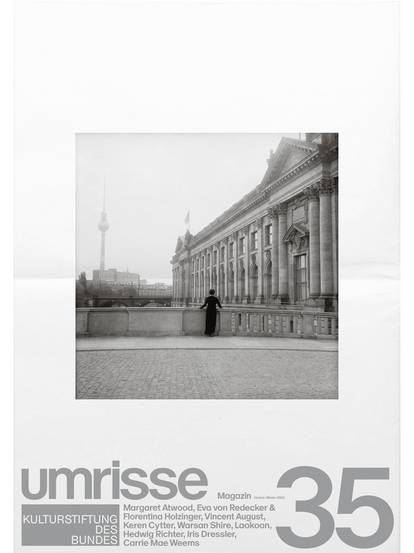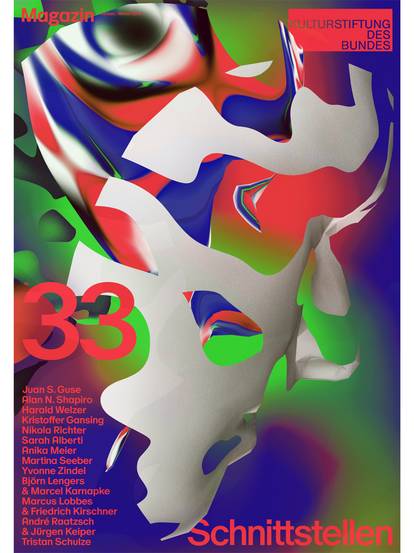Das Tragische und das Komische. Was Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“ mit seinem „Woyzeck“ verbindet. Von Monika Rinck
Sie kennen Georg Büchners berühmte Komödie „Woyzeck“? Dann kennen Sie sicherlich auch sein Trauerspiel „Leonce und Lena“. Falls Ihnen diese Fragen nicht widersinnig erscheinen, kennen Sie vermutlich weder „Woyzeck“ noch „Leonce und Lena“. Ah, das war ein Scherz. Dennoch: Bitte lassen Sie diese Brille noch einen Moment auf.
Es scheint einfacher zu sein, das komödiantische Potenzial in „Woyzeck“ freizulegen, als die tragische Grundtendenz in „Leonce und Lena“ erkennen zu wollen. Oder ist es umgekehrt? Henri Bergson schreibt in seinem Buch „Das Lachen“, dass „die Komik vor allem eine besondere Unfähigkeit des Menschen, sich der Gesellschaft anzupassen, widerspiegele“, und dass dort, wo sich ein Mensch gegen die Integration in die Gesellschaft sträube, eine Versteifung eintrete. Diese Versteifung werde allerdings von der Gesellschaft nur sehr ungern gesehen; daher diene das Lachen als zuweilen auch demütigende Korrektur – zur Re-Kollektivierung des Versteiften. Ein eigenartig fühlloses Miteinander tut sich in dieser Theorie auf, was uns einen ersten Hinweis darauf gibt, dass das Komische nicht zu verharmlosen ist.
Freilich bewegt man sich hier auf schlingerndem Terrain, denn der verrohte Mensch kann schließlich über alles lachen. Diese Möglichkeit soll uns nun kein Argument sein. Doch hilft es dem Unglücklichen zu wissen, dass ich nicht wegen, sondern trotz seines Unheils lache? Komik und Schauer „haben bei aller Gegensätzlichkeit der Wirkung manches miteinander gemein“, heißt es im Büchner Jahrbuch aus dem Jahr 1983, „etwa die Entgrenzung des Verstandes zugunsten der Einbildungskraft. Komik und Schauer konvergieren in einer physiologischen Wahrnehmungsästhetik. Im Schauer als präreflexiver, körperlich nervlicher Sensation der Empfindungen werden die ungelösten Fragen und abstrakten Antworten der Philosophie mit unmittelbarer, konkreter Daseinsangst beantwortet. Im Komischen hingegen, dessen Dimension vom Vorreflexiven zum Reflexiven reicht und aus der Plötzlichkeit und Unvermitteltheit ihres Zusammentreffens lebt, wird das Philosophieren zentral.“
Hier kommt die schwer leserliche, aber schier evidente Urteilskraft des Körpers ins Spiel, außerdem: Angst als das Gegenüber von Philosophie. Sowohl das Gelächter als auch der erschreckte Aufschrei gehören zu den Formen des reflexhaften Ausdrucks, die der Religionsphilosoph Klaus Heinrich als Realsubstrat (einer kultischen Handlung) fasst. Es sind diese konvulsivischen Bewegungen, die auf eigenständige Art für die psychosomatische Wirklichkeit einstehen – sei es eines Kultaffekts, einer inneren Verwerfung oder einer ästhetischen Erfahrung – denn Gottesschau und Theater kommen aus der gleichen sprachlichen Wurzel: theoria. Ich lache (Demütigung und Korrektur) – über ein Laster, das mich nicht bewegt, sagt Bergson, und unterstreicht hiermit erneut, dass mangelnde Empathie eine Voraussetzung für Amüsement sein kann. Wünschte sich Büchner, dass im imaginären Publikum seines erst 1895 in München erstaufgeführten Dramas „Leonce und Lena“ eine Lachgemeinschaft entstünde, ein heiteres oder höhnisches Bündnis gegen die turtelnden adeligen Nichtstuer?
Heutzutage erkennt man schon an, dass die Eliten fleißig arbeiten, aber oft in leerer Emsigkeit ausbrennen, hilflos angesichts unendlich komplexer globaler Vernetzungen des Marktes – zumindest stellt man es so dar. Das Geschehen an den Börsen als Orakel von Delphi jeweils zur vollen Stunde versendet und im Glutkern der symbolischen Ordnung ein komplett imaginäres Verdampfen – das ist nicht ohne Witz.
In der Komödie zeigt sich exemplarisch, dass die symbolische Ordnung bekanntermaßen durch ihr Misslingen glückt. Die ganze Komödie spricht dafür – und lacht deswegen. Das Lachen ist damit sowohl die Anerkennung der Ordnung als auch ihr Unterlaufen, weswegen Baudelaire es zu den künstlerischen Phänomenen zählt, die dem Menschen seine Mehrdeutigkeit offenbarten, das Vermögen, zugleich man selbst und ein anderer zu sein. „Das Ich, das unter dem Einbruch der Triebladung, die das Symbolische zerreißt, lacht, ist nicht das Ich, das beobachtet und erkennt“, schreibt Julia Kristeva in der „Revolution der poetischen Sprache“. Aber es trägt zumindest noch die Kontur des beobachtenden Ichs, etwa nach der Art, wie Bergson das Lachen als Schaum auf den Wogen beschreibt, der an der Oberfläche den Aufruhr in der Tiefe nachbildet.
Eine Art von philosophischem Slapstick
Gelächter muss allerdings zurück übersetzt werden, wenn es seinen kritischen oder erkenntnisrelevanten Part einholen will. Vorerst flutet es die Urteilskraft, es flutet den ganzen Erkenntnisapparat. Gert Mattenklott beschreibt sehr schön diesen Ausbruch ins Alberne – und ins ganz Andere. „Dieses Lachen steigt auf aus der Körpermitte, scheinbar eine wilde, unüberlegte, reflexhafte Reaktion gegen alles Kultivierte und alle disziplinierenden Zumutungen. Der alberne Strudel macht vor Nichts halt, d.h., er hält nicht eher ein, als bis das Nichts erfahren worden ist. In den Krämpfen der Albernheit wird das Bedeutende aus dem Körper geschwemmt bis zur körperlichen Erschöpfung, eine Vernichtung alles bürgerlich Repräsentativen nicht nur, sondern – weit radikaler – der Ordnung von Repräsentation. Es gibt nur noch Zeichen, kein Bezeichnetes, nur Worte oder Gesten, keinen Sinn.“
So ausgelacht, lässt die Komödie den Zuschauer im besten Fall erschöpft und heiter untätig zurück. Die Tragödie dagegen dürfe, so die antike Rhetorik, als Vorbereitung auf kommendes Unheil gelten – und sei schon allein deswegen der Komödie überlegen, die sich etymologisch etwas unsicher entweder von komoi: „ausgelassene Umzüge mit allerlei Schabernack“ oder komai herleitet: Vororte, in denen die als ehrlos aus der Stadt vertriebenen Komödianten umherziehen, wie Rudolf Helmstetter anmerkt. Das Personal der Tragödie entstammt den höheren Klassen, Götter treffen dort auf Halbgötter, auf Könige und Königinnen, metaphysische Ordnungen kollidieren. Die Komödie rangiert unter den niedrigen Gattungen, und ihr Personal entstammt dem niedrigen Stand. Das ist in unserem Beispiel nun allerdings umgekehrt: „Woyzeck“ spielt im einfachen bis verelendeten Milieu, das Lustspiel „Leonce und Lena“ ist im Hochadel der Kleinstkönigtümer Pipi und Popo angesiedelt.
Fiktion und Wahrheit
Freilich entsprechen der Komödie und der Tragödie unterschiedliche Menschenbilder, die sich seit der Antike immer wieder gewandelt haben. Es zeigt sich ihr je eigenes Verhältnis von Fiktion und Wahrheit, von Ich und Ich-Ideal, Subjektivierung und Objektivierung, Handlungsfähigkeit und fatalistischem Ablassen, von Freiheit und Vorsehung und was dergleichen Oppositionen mehr sind.
Doch erlauben Sie mir, nochmals auf Bergson zurückzukommen: „Das Komische an einem Menschen ist das, was an ein Ding erinnert. Es ist das, was an einen starren Mechanismus oder Automatismus, einen seelenlosen Rhythmus denken lässt.“
Ist es vielleicht so: Da das Ding doch noch Seele hat, entwringt sich Komik, als würde man beides gegeneinander verdrehen? Hier geistert die Idee der körperlichen Unempfindlichkeit herum, die in vielen Slapstickfilmen anschaulich wird. Der Begriff des Slapsticks leitet sich übrigens ab von der Klatsche, die der Harlekin der „Commedia dell‘Arte“ zum Einsatz kommen lässt. Sie ist laut, aber wenig schmerzhaft, heißt es. Wir kennen den Einsatz der Klatsche, genauer des Stocks, im Zusammenhang mit philosophischer und religiöser Lehre. Büchner führt an einigen Stellen in beiden Dramen eine Art von philosophischem Slapstick vor – unter dem vor allem Woyzeck zu leiden hat. Doch Büchners Hohn gilt denen, die Philosophie, Wissenschaft generell, nutzen, um Hierarchien zu befestigen, um Menschen mittels wissenschaftlichen Fortschritts zu demütigen. Und dieser Fortschritt nimmt zur Zeit Büchners enorm an Fahrt auf. „Der Status des Menschen im Denken der Moderne ist von Grund auf uneindeutig“, schreibt Eduardo Viveiros de Castro im Animismus-Reader „Revisionen der Moderne“. „Einerseits ist der Mensch eine Tierart unter anderen, und das Tierreich umfasst auch den Menschen; andererseits ist das Menschsein ein moralischer Zustand, der Tiere ausschließt. Im problematischen, disjunktiven Begriff „menschliche Natur“ existieren diese beiden Zustände nebeneinander.“ Büchner ist der Erste, der die revoltierende Erkenntnis vom biologischen Menschen künstlerisch umsetzt: seine physische Kontinuität bei metaphysischer Diskontinuität. Er schreibt, wie Durs Grünbein formuliert hat, „das Drama des biologischen Menschen, die Kritik der reinen Vernunft aus der Natur des Schmerzes“. Zum Beispiel da, wo der Doktor seinen Probanden Woyzeck tadelt, weil der die Auswertung seines Experiments erschwert hat, indem er sich bereits erleichtert hat, und Woyzeck sich mit den Worten verteidigt: „Aber Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt.“ Doktor: „Die Natur kommt, die Natur kommt! Die Natur! Hab ich nicht nachgewiesen, dass der musculus constrictor vesicae dem freien Willen unterworfen ist? Die Natur! Woyzeck, der Mensch ist frei, in dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit.“ Nähern wir uns dem Menschlichen nun einmal von seinen Rändern her, dazu noch aus verschiedenen Richtungen. Betrachten wir zum einen das astronomische Pferd auf dem Jahrmarkt aus dem „Woyzeck“, Bewusstsein als Sensation!, zum anderen den Auftritt der großartigen Automaten in „Leonce und Lena“.
„Leonce und Lena“ – zwei adlige Heiratsautomaten
Da preist der Jahrmarktsausrufer seine Menagerie, die aus einem Kanaillenvogel und einem hochbegabten Pferd besteht: „Alles Erziehung, haben eine viehische Vernunft, oder vielmehr eine ganze vernünftige Viehischkeit, ist kei viehdummes Individuum wie viel Person, das verehrliche Publikum abgerechnet.“ An diese Art der marktschreierischen Vorführung wird der Leser oder Zuschauer sich später erinnern, wenn Woyzeck im Hof des Professors der Studentenschaft vorgeführt wird. Doch bleiben wir noch einen Moment auf dem Jahrmarkt: „Zeig dein Talent! Zeig dein viehische Vernünftigkeit! Bschäme die menschlich Sozietät! Sehn Sie jetzt die doppelte Räson! Das ist Viehsionomik. Ja das ist kei viehdummes Individuum, das ist ein Person! Ei Mensch, ei tierische Mensch und doch ei Vieh, ei bête. (Das Pferd führt sich ungebührlich auf.) So bschäm die Societé. Sehn Sie, das Vieh ist noch Natur, unverdorbe Natur! Lern Sie bei ihm.“ Das Pferd, so komplettiert durch viehische Vernünftigkeit, hat dem Menschen nun sogar etwas voraus: nämlich, dass es seine Natur nicht verleugnen muss. Der Mensch hingegen wird in eine neue dilemmatische Klemme genommen. Ich erinnere kurz an einen Ausspruch Heinrich Heines, der irgendwo anmerkte, dass die Affen eigentlich auch Menschen seien und nur deswegen nicht sprächen, um nicht zum Arbeiten gezwungen zu werden. Eine industrielle Utopie sah einmal vor, dass alle Arbeit von Automaten verrichtet werden sollte. Dieses Versprechen wurde allerdings insofern nur pervertiert eingelöst, als viele Menschen im Dienste des Arbeitsprozesses zu Automaten gemacht wurden – oder Arbeitslosigkeit erlitten.
Auch die adligen Heiratsautomaten aus „Leonce und Lena“ gehören gewissermaßen zur Gattung von Adornos Automatenmenschen, die starr sind, weil sie sich selber als die Automaten erfahren, als die sie in der Welt verwendet werden: „Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und Uhrfedern.“ Die Automaten sind auf den Glockenschlag geeicht und kulturell gebildet, in jeder Hinsicht perfektioniert. Im jüngsten Versuch, die Moderne einer Revision zu unterziehen, finden sich diverse Ansätze einer emanzipativen Objektivierung oder Selbstverdinglichung – etwa die Sehnsucht der verdinglichten Seele, ganz Ding zu werden. Auch andere nicht-westliche Konzepte von Subjektivität werden debattiert, die von den Beziehungen ausgehen, die zwischen Menschen, Tieren und beseelten Dingen bestehen. Das führt zu Konzepten von Kollektivität, in denen die Relationen zentral sind, so dass die Beziehungen einerseits in das Wesen Einzug halten und das Wesen gleichsam durch sie erweitert wird – eine Ausweitung der Sensibilität, der vielleicht das gesteigerte ökologische Bewusstsein hierzulande entspricht. Das nur am Rande, ich möchte auf die harsche Realität der Verdinglichung durch Zwangsarbeit und Experiment zu Sprechen kommen. Wir erinnern uns: Woyzeck geht in die pharmazeutische Prostitution, er verpflichtet sich, nur noch Erbsen zu essen und wird für die Darbietung der krankhaften Phänomene honoriert, die in ihm stattfinden. Dieses Experiment, so nimmt die Büchner-Forschung an, hatte wohl den Zweck, herauszufinden, ob man ein Heer auch mit Hülsenfrüchten allein ernähren könnte. Es geht also letztlich um Rationalisierung. Jüngst war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen: „EU will Tests an Menschen erleichtern.“ Unabhängige Ethikkommissionen sollen bei klinischen Tests nicht mehr beteiligt werden müssen – was auf einen niedrigeren Schutzmechanismus hinausläuft, als er beim Tierversuch Usus ist. „Die europäische Kommission behauptet, das bisher hohe Schutzniveau habe zur Behinderung der Forschung geführt, die Zahl der klinischen Prüfungen in der EU sei von 2007 bis 2011 um 25 Prozent zurückgegangen. Es handelt sich freilich um den Zeitraum, in dem wegen der Wirtschaftskrise Investitionen weltweit eingebrochen sind.“ Kurzum: Es geht um Gewinnmaximierung. Beweist das nun Büchners Hellsichtigkeit oder unsere Rückständigkeit? Niemals waren Arbeitssklaven so billig wie heute, niemals stellten die weltweiten Gesellschaftsverhältnisse so viele „versklavbare“ Menschen zu einem so günstigen Preis zur Verfügung. 2009 ging die ILO (Internationale Arbeitsorganisation der UNO, die sich für menschenwürdige Arbeit einsetzt) von etwa 12,3 Millionen als Sklaven arbeitenden Menschen weltweit aus. Andere Schätzungen setzen die Zahl weit höher an, bei bis zu 30 Millionen Menschen.
„Lieber möchte ich meine Demission als Mensch geben.“
Nein, das ist sicher nicht komisch. Eine erbarmungslose Formel sieht vor: Wer sich nicht hat, kann sich auch nicht verlieren. Der Genuss an der Verdinglichung entspringt einer ganz anderen Logik. Der Sprung zurück zu „Leonce und Lena“ mag willkürlich scheinen, aber so sind die Verhältnisse. Die erste Szene zeigt uns Leonce, der dem Hofmeister gegenüber behauptet, er habe alle Hände voll zu tun, da er noch keine 365 Male auf einen Stein gespuckt habe. Seinem Freund Valerio genügt es, den lieben langen Tag das Lied von Fleig an der Wand zu singen. Überhaupt weitet Leonce das Adelsprivileg Langeweile zur generellen Triebfeder des Lebens aus – ihm selbst jedoch reicht es, sie zu genießen, wenn sich zuweilen auch ein melancholisches Verlangen nach Tätigkeit regt. Die an sich handlungsmächtigen Adligen lehnen jede Anwendung dieser Macht ab. Wenn Valerio nach Wissenschaft, Heldentum, künstlerischem Genie als zweitletzte Möglichkeit der Selbstverwirklichung gesellschaftliches Engagement vorschlägt: „So wollen wir nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden“, antwortet Leonce unmissverständlich: „Lieber möchte ich meine Demission als Mensch geben.“ Woyzeck hingegen wird jede Handlungsfähigkeit abgesprochen, obwohl er rennt, rennt, rennt, bis er im Affekt seine Freundin ersticht, ein Geschehen, das heute noch in der deutschen Nachrichtensprache gedankenlos „Familiendrama“ genannt wird. Was passiert mit dem Lob des Müßiggangs, wenn es auf verzweifelte Armut trifft? Bertrand Russells aus der Analyse der reduzierten Kriegswirtschaft gewonnene Einsicht, dass niemand länger als vier Stunden täglich arbeiten sollte, mutet angesichts der weltweiten Realität von Zwangsarbeit beinah frivol an: „Ich möchte in vollem Ernst erklären, dass in der heutigen Welt sehr viel Unheil entsteht aus dem Glauben an den überragenden Wert der Arbeit an sich, und dass der Wert zu Glück und Wohlfahrt in einer organisierten Arbeitseinschränkung zu sehen ist. (…) Die Moral der Arbeit ist eine Sklavenmoral, und in der neuzeitlichen Welt bedarf es keiner Sklaverei mehr. Niemand auf Erden sollte länger als vier Stunden arbeiten, um in der so gewonnenen Zeit wissenschaftlichen, freundschaftlichen und künstlerischen Neigungen nachzugehen.“
Nun ja, man muss nicht an den Wert der Arbeit glauben, um ausgebeutet zu werden. Das ist das Dilemma, das Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“ mit seinem „Woyzeck“ verbindet. Die Komik nimmt kein Ende. Die Verwechslungen hören nicht auf.