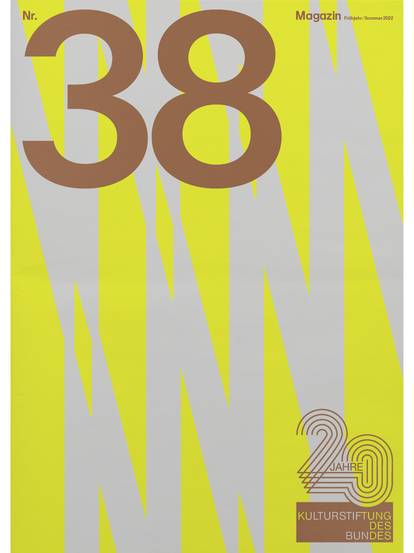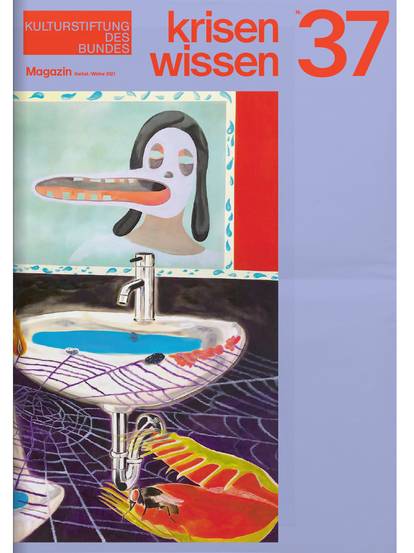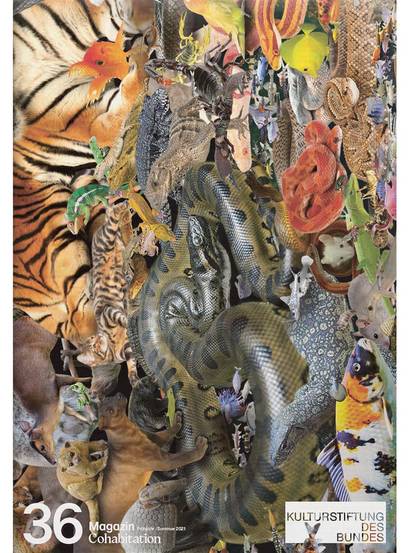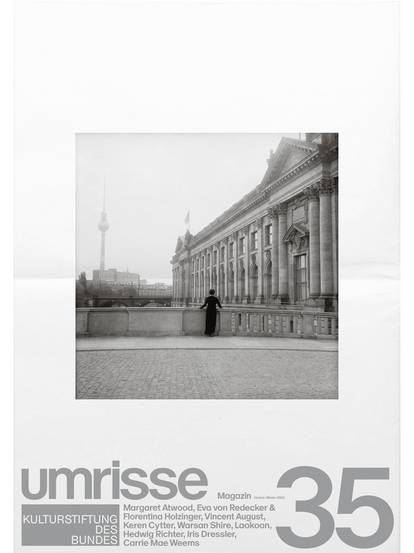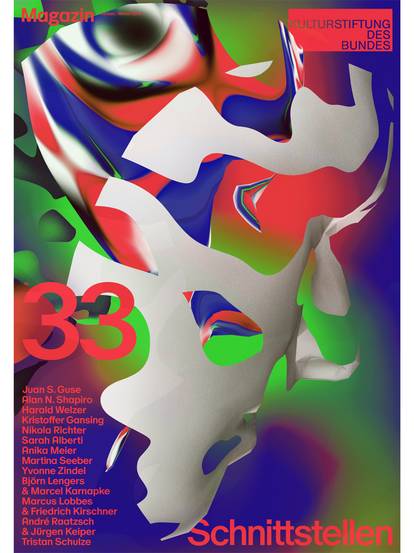Seit Museen, Gedenkstätten, Archive und Bibliotheken in den Augen vieler öffentlicher Träger zu Konkurrenten der modernen Unterhaltungsindustrie geworden sind, hat sich auch ihre gesellschaftliche Wahrnehmung verändert. Das möglichst spektakuläre Ausstellen eigener und fremder Bestände ist zur Hauptdisziplin, die Besucherschlange vor dem Eingang zum vermeintlich einzig relevanten Gradmesser ihrer Bedeutung geworden. So jedenfalls sehen es viele jener Verantwortlichen, die in Parlamenten, Ausschüssen und Kommissionen regelmäßig über die Finanzen zu entscheiden haben, mit denen die Horte unseres kulturellen Gedächtnisses ausgestattet werden müssen. Dass sich die Kriterien für dieses regelmäßige Verteilungsverfahren längst an den Vorgaben des kommerziellen Unterhaltungsbetriebs orientieren, zwingt die Leiter der öffentlichen Bildungsinstitute zu einem absurden dauerhaften Wettkampf: Nur wer sichtbar ist —. in den Medien oder wenigstens in der öffentlichen Diskussion — gilt denen, die das Geld verteilen, noch als wichtig. Und sichtbar ist, wer Aufmerksamkeit erregt, indem er sich selbst möglichst häufig vorteilhaft darstellt. Dass dann auch schon einmal eine Caravaggio-Ausstellung gar keinen Caravaggio enthält, eine Modigliani-Retrospektive über ein Dutzend mutmaßlicher Fälschungen zeigt oder eine Leonardo-Schau neben Faksimiles kein einziges Original des Renaissance-Meisters darbietet, ist nur eine der negativen Folgen dieser Entwicklung.
Ungleich schwerer wiegt, dass inzwischen nicht mehr viel ist von den ursprünglich drei weiteren gleichberechtigten Aufgaben zu sehen ist, die sich die Museen, Bibliotheken und Archive einmal gegeben hatten, als ihre Sammlungen vor vierhundert Jahren aus der Exklusivität privater Kunst- und Wunderkammern in die sich langsam entwickelnde bürgerliche Öffentlichkeit entlassen wurden. Wie sollte es auch? Das Präsentieren der eigenen Bestände, das klassische Aufbereiten und Ausstellen eben, ist eine nach außen, an ein Publikum gerichtete Aktivität. Die drei anderen klassischen Archiv- und Museumsaufgaben aber — das Sammeln, das Forschen und das Bewahren — richten sich nach innen und sind für eine unmittelbare Öffentlichkeit schon deshalb nicht gedacht, weil sie zunächst nur die wenig attraktiven Voraussetzungen für die spätere Präsentation kultureller Schätze zu sein scheinen.
Wen interessieren die Verhandlungen, die der Direktor eines kommunalen Archivs mit dem Kulturausschuss und dem Stadtkämmerer führen muss, bis endlich ein seit Jahrhunderten in Familienbesitz befindlicher, für die Stadt unendlich wichtiger Foliant ins öffentliche Eigentum übergehen kann? Wer möchte all die seitenlangen Fachaufsätze lesen, die in abseitigen Jahrbüchern den Inhalt eines mühevoll erworbenen Nachlasses akribisch analysieren? Und wen kümmert es schließlich, mit welchen technischen, chemischen und physikalischen Methoden versucht wird, ein Kulturgut auch für kommende Generationen noch sicht- und studierbar zu erhalten? Wir leben im visuellen Zeitalter, in dem nur interessiert, was angesehen werden kann —. nicht aber der mühsame Weg, der erst zur kollektiven optischen Aneignung in den Schauräumen führt, der sie vorbereitet und dadurch überhaupt erst ermöglicht.
Dabei nimmt gerade das Bewahren einen immer breiteren Raum in der täglichen Arbeit jener Fachleute ein, die treuhänderisch jene Kulturgüter erhalten, die die Geschichte dieses Landes, dieses Kontinents und dieser Welt erzählen und ihre Identität in ihrer ganzen Vielfalt maßgeblich mitprägen. Der Grund für die zunehmende Bedeutung dieser Aufgabe ist zunächst, ganz profan, quantitativer Natur: Immer mehr Menschen erzeugen immer mehr Artefakte und kulturelle Zeugnisse, über deren Erhalt zumindest nachgedacht werden muss. Das historische Bewusstsein wächst, der Wunsch nach geradezu enzyklopädischen Sammlungen wird immer größer. In Berlin soll demnächst das Humboldt-Forum die Kulturgeschichte der Welt erzählen. Häuser mit ähnlich monumentalem Anspruch machen in London, Paris und Washington bereits vor, wie man das museologisch versuchen kann — mit möglichst vielen Originalen aus aller Welt, die es zu konservieren gilt. Es klingt absurd: In einer globalisierten Welt, die aus sich selbst heraus ständig neue virtuelle Welten erzeugt, wächst offenbar von Tag zu Tag das Bedürfnis nach realen Gegenständen, die angesehen und durch Erklärungen verstanden werden können. Man will die immer kompliziertere Welt wieder anfassen können, um sie zu begreifen.
Gleichzeitig zerrinnen aber den Archiven, Bibliotheken und Museen die Kulturgüter, die ihnen im Laufe der vergangenen Jahrhunderte anvertraut wurden, buchstäblich zwischen den Fingern — weil das Material altert und sich zersetzt. Ein Blick auf die lange Liste jener Projekte, die die Kulturstiftung des Bundes im Rahmen ihres Programmes KUR zur Konservierung und Restaurierung von mobilem Kulturgut fördert, vermittelt einen guten Querschnitt durch Qualität und Quantität jener Aufgaben, die sich von Flensburg bis Füssen und von Aachen bis Frankfurt an der Oder stellen. Hätte es zu seiner Zeit schon Archive und Bibliotheken gegeben, hätte Sisyphos den Felsblock nie gebraucht.
Da müssen in der Berliner Staatsbibliothek Tausende von Zeitungsseiten aus den vergangenen 150 Jahren laminiert werden, um die zerbröselten Teile zu fixieren, damit sie digitalisiert werden können. Da gilt es, Methoden zu finden, um 2.000 Wachsmoulagen im Deutschen Hygiene-Museum Dresden zu konservieren, die als frühe optische Dokumentation von Krankheiten zugleich Ausbildungshilfen wie Ausstellungsstücke waren. Da müssen die Zinnsarkophage in der Fürstengruft des Merseburger Doms zunächst einmal überhaupt statisch gesichert und von Schmutzschichten befreit werden, die die Verzierungen völlig überdeckt haben. Da verdunstet aus den in rund 260.000 Gläsern konservierten Tierpräparaten der sogenannten Nasssammlung des Museums für Naturkunde in Berlin der Alkohol durch undichte Verschlüsse und starke Temperaturschwankungen — vor dem selben Problem stehen ähnliche Sammlungen auf der ganzen Welt. Historische Tasteninstrumente in Weimar und umbrische Tafelbilder in Altenburg, die Architekturzeichnungen von Hans Scharoun und die Stoffentwürfe der Textildruckfabrik Pausa im württembergischen Mössingen — zahlreiche dieser völlig unterschiedlichen Aufgaben haben nur eines gemeinsam: Für sie gibt es kein einfach anzuwendendes Patentrezept. Für jede dieser restauratorischen Aufgaben muss zunächst — in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstituten — überhaupt erst einmal eine Methode entwickelt werden, den Verfallsprozess eines bestimmten Materials zu stoppen, um anschließend bereits entstandene Schäden zu reparieren. Das Problem des Zerfalls von Elastomeren etwa — formfeste elastische Kunststoffe wie Reifen, Gummibänder oder Dichtungen — hat sich vergangenen Generationen von Restauratoren noch gar nicht stellen können, weil der Zersetzungsprozess dieses Materials erst jetzt als akutes Problem wahrgenommen wird. Mehrere Labore und Institute, vom Deutschen Bergbaumuseum in Bochum bis zum Filmmuseum Potsdam —. suchen deshalb nun gemeinsam nach Lösungen, weil ihre Sammlungen auf unterschiedliche Weise vom gleichen Problem betroffen sind.
Kultur der Kur...
Schon seit längerem gibt es zwei ethische Grundsätze der Restaurierungsphilosophie, von denen sich erst noch erweisen muss, wie weit sie sich von der Bildenden Kunst auch auf andere Bereiche und noch zu entwickelnde Techniken übertragen lassen: die Prinzipien der Authentizität und der Reversibilität. Danach soll auch nach der bestandserhaltenden Bearbeitung eines Gemäldes, einer Zeichnung oder einer Plastik der Unterschied zwischen dem ursprünglichen Werk und seinen nachträglichen Retuschen noch sichtbar bleiben. Die Restaurierung beschädigter oder die Ergänzung fehlender Bildflächen darf, so der fachübergreifende Konsens, nicht zu deren kongenialer Fälschung führen und dem Betrachter eine Echtheit vorgaukeln, die nicht mehr gegeben ist. Ausführliche Dokumentationen, die die verschiedenen Stadien der Arbeit auch im Foto festhalten, gehören heute zum Standard.
Es gibt aber auch die Auffassung, dass man gar nicht erst versuchen sollte, dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Fehlte in einem Heiligenbildnis — etwa als Folge des reformatorischen Bildersturms des 16. Jahrhunderts — ein Teil des Gesichtes, wurde die Leinwand einfach nachgewoben und mit einer monochrom grauen Farbfläche ausgefüllt.
Gleichzeitig gilt das Prinzip der Reversibilität: Sollte irgendwann einmal ein besseres Verfahren gefunden werden, mit dem sich der Alterungsprozess bei jenen buddhistischen Wandmalereien des 5. bis 12. Jahrhunderts von der nördlichen Seidenstraße aufhalten lässt, die vor rund hundert Jahren ins Berliner Museum für Asiatische Kunst gebracht wurden, so dürfen die heutigen Sicherungsmaßnahmen einer späteren Anwendung nicht entgegenstehen. In den 1970er und 1980er Jahren hatte man versucht, die fragilen Bilder mit Hilfe von kunststoffhaltigen Bindemitteln zu stabilisieren. Inzwischen hat man erkannt, dass auch die dabei eingesetzten Acrylate und Polyvinylacetate Alterungsprozessen unterliegen, die die Bildoberflächen nachhaltig verändern können. Also müssen die Wissenschaftler dort nun — unter anderem in Zusammenarbeit mit Kollegen von der Universität Peking — zunächst die Arbeit ihrer Kollegen von vor 30 Jahren revidieren, bevor sie sich an die Lösung des eigentlichen Problems machen können. Für die europäische Malerei war es lange Jahre üblich, fragile Leinwände zu doublieren, indem man sie mit einem weiteren textilen Trägermaterial hinterklebte. Die dabei verwendeten Wachsverbindungen schlagen im Laufe der Jahrzehnte aber bis in die Malschichten durch und drohen, sie zu zersetzen. Was einst als Rettung gedacht war, erweist sich heute als ungewollter Beitrag zur Zerstörung eines Kunstwerks. Van Goghs Gemälde sind dadurch an zahlreichen Stellen sichtbar nachgedunkelt.
Manchmal allerdings lässt sich diese zweite Arbeitsgrundlage, das Prinzip der Reversibilität, nicht umsetzen — weil die schlichte Rettung vom Verfall bedrohter Kulturgüter unter Zeitdruck die wichtigere Entscheidung darstellt. Die in Berlin laminierten Zeitungsseiten zum Beispiel werden sich aus den Plastikfolien, zwischen die sie zur Stabilisierung eingeschweißt werden, nicht mehr herauslösen lassen. Das kann man bedauernswert finden, man muss es aber nicht. Hier geht es um die grundsätzliche Entscheidung, Inhalte zu retten — nicht Material. Beides zusammen scheint bislang nicht möglich — wie es vielleicht allgemein in Zukunft schon aufgrund der Fülle des sich ansammelnden Materials immer häufiger nicht mehr möglich sein wird, die Kultur der Menschheit in all ihren vielfältigen Zeugnissen durch deren Erhalt zu dokumentieren. Vielleicht müssen wir uns deshalb von der Vorstellung verabschieden, eine Idee könne nur dann überleben, wenn sie materialisiert erhalten wird und sich bis in alle Zeiten in ihren originalen Überlieferungen authentisch visualisieren lässt.
Diese Überlegung allerdings bricht in unserer Bildungs- und Kulturgesellschaft ein bislang bestehendes Tabu, denn sie führt zur viel grundsätzlicheren Frage, was vor dem Hintergrund einer sich immer schneller entwickelnden und verändernden Weltgesellschaft in Zukunft überhaupt an den Orten kollektiver gesellschaftlicher Erinnerung noch zu leisten sein wird. Tabuisiert ist diese Frage, weil sie ans Selbstverständnis von Museen, Archiven und Bibliotheken rührt. Deren Aufgabe wird in den 1986 vom internationalen Museumsverband ICOM beschlossenen und 2001 ergänzten Ethischen Richtlinien für Museen klar definiert. Im Kapitel über die »Verantwortlichkeit gegenüber den Sammlungen« heißt es:
»Eine grundlegende Verpflichtung aller Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter besteht darin, für die angemessene Pflege und Konservierung von Sammlungen und Einzelstücken zu sorgen, für die ihre Institution verantwortlich ist. Sie müssen in der Absicht handeln, die Sammlungen unter Berücksichtigung des aktuellen Wissensstandes und der zur Verfügung stehenden Mittel so gut und sicher wie möglich zu erhalten, um sie an künftige Generationen weitergeben zu können.«
Die wesentlichen Einschränkungen dieses Grundprinzips, die Originalzeugnisse der Menschheitskultur dezentral für kommende Generationen zu bewahren, formulieren die Richtlinien gleich mit: An der Weiterentwicklung des »aktuellen Wissensstandes« arbeitet jede Restauratoren- und Konservatorengeneration neu. Jene können sich also ändern und auch zur Erkenntnis führen, dass manches nicht für alle Zeiten zu retten sein wird. Die »zur Verfügung stehenden Mittel« aber, die zweite Einschränkung der Regel, entwickeln sich schon seit Jahrzehnten zum Dauerproblem: Für die Aufgabe der Bewahrung der öffentlichen Sammlungen nämlich fehlen diese Mittel immer wieder.
Der Deutsche Museumsbund formulierte 2006 in seiner Denkschrift Standards für Museen das eigene Selbstverständnis auf ganz ähnliche Weise so, dass es sicher auch die Verantwortlichen in Archiven und Bibliotheken ohne größere Bedenken würden unterschreiben können:
»Das Museum hat den Auftrag, Zeugnisse der Vergangenheit und der Gegenwart dauerhaft zu erhalten und für die Zukunft zu sichern.« In diesem ersten Satz der selbst verordneten Aufgabenbeschreibung fehlt der Originalbegriff, der allerdings schon im zweiten Satz dadurch eingeführt wird, dass man »spezifische Kenntnisse über Sicherheit, Klima, Materialeigenschaften, Schadensbefund und Schadensprozesse, Handhabung der Objekte sowie Konservierungs- und Restaurierungsverfahren« fordert.
Bleiben wir aber doch einmal beim ersten Satz dieser Agenda und wagen ein Gedankenspiel: Muss die dort formulierte Aufgabe, »die Zeugnisse der Vergangenheit und der Gegenwart dauerhaft zu erhalten und für die Zukunft zu sichern«, notwendigerweise auf den Erhalt und die Sicherung von Originalen bezogen werden? Wäre es nicht auch denkbar, sich vor dem Hintergrund von Geld- und Platzmangel, von technischen und personellen Problemen und eines Kampfes gegen den Verfall, der in einigen Fällen schon jetzt verloren ist, auf die Konservierung von Inhalten zu konzentrieren? Und gilt dies nicht vor allem für vervielfältigte Werke — etwa für Bücher, die zum Teil in hohen Auflagen gedruckt wurden, oder für die technischen Medien, deren Dokumentenproduktion kommende Generationen von Archivaren vor Aufgaben stellen werden, die sich zur Zeit bestenfalls erahnen lassen?
Vielfach, auch bei den KUR-Projekten gibt es dafür Beispiele, sind die Originale ohnehin nicht mehr zu retten wie zum Beispiel im Fall der rund 68.000 Filmnegative in der Sächsischen Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, die unter anderem den Zustand der Städte Berlin, Leipzig und Dresden nach 1945 dokumentieren: »Die Negative sind durch bereits begonnenen materiellen Verfall akut bedroht — ein Verlust, der nach heutigem Wissensstand nicht aufzuhalten oder rückgängig zu machen ist — und können langfristig nicht im Original erhalten werden. In diesen Fällen geht es um die Sicherung der Informationen«, so heißt es in der Projektbeschreibung der Kulturstiftung des Bundes.
...oder Kultur des Bruchs?
In der Vergangenheit waren es häufig kulturelle oder zivilisatorische Katastrophen, die Brüche im Umgang mit der Vergangenheit erzwungen oder zugelassen haben. Kriege und Eroberungen führten dazu, dass riesige Bestände an Dokumenten, Archivalien und Kulturgegenständen verschleppt oder zerstört wurden. Technische Unglücksfälle wie der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar oder der fremdverschuldete Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln vernichteten ebenfalls eine unschätzbare Menge an Originalen. In Köln wird inzwischen laut darüber nachgedacht, das Archiv an gleicher Stelle wieder aufzubauen. Eine zynische Begründung dafür lautet, nun sei ja erst einmal wieder ausreichend Platz vorhanden, weil bis zu einem Viertel des ehemaligen Bestandes verloren sein könnte. Die drohende Niederlage gegen die Zeit und ihre zerstörerischen Folgen in immer mehr Bereichen und die Erkenntnis, dass —. ausgelöst durch die Bevölkerungs- und die dadurch bedingte Wirtschaftsentwicklung — mittelfristig weder das notwendige Personal noch das Geld zur Verfügung stehen werden, könnte eine Neuorientierung im Umgang mit den Zeugnissen der Vergangenheit auch ohne solche Katastrophen fordern. Vom Anspruch, eine Kulturnation zu sein, müsste sich die Bundesrepublik trotzdem nicht verabschieden.
Was spräche dagegen, dass auch die in der Berliner Staatsbibliothek zu laminierenden Zeitungsseiten im unhandlichen Folio-Format vernichtet werden, sobald sie digitalisiert wurden? Ihre Inhalte wären gesichert. Was an ihnen einmal wichtig sein könnte, muss deshalb heute niemand vorhersehen können. Das schlechte Holzschliffpapier jedenfalls wird es nicht sein. Und die Aura des Originals haben die Blätter durch das irreversible Einschweißen in Plastikfolie ohnehin verloren, aufblättern wird man sie danach nie wieder können. Schon jetzt arbeiten viele Wissenschaftler ja nicht mehr mit Originalen, sondern mit Kopien und Scans. Wer etwa die Kundenkartei der legendären Galerie Thannhauser studieren will, die das Zentralarchiv des Internationalen Kunsthandels in Köln aufbewahrt, kann mit einer hervorragenden Datenbank arbeiten, in der sich die Digitalversionen der dünnen Blätter durch Vergrößerungsmöglichkeiten viel besser lesen lassen als die fragilen Originale. Weltweit haben sich bereits Bibliotheken zu Forschungsverbünden zusammengeschlossen, um sich den virtuellen Zugang zu ursprünglichen Realien zu ermöglichen — Google Books in einer nicht-kommerziellen Variante?
Wer die Frage nach der gesellschaftlichen Option auf eine neue, friedliche Kultur des kulturellen Bruchs in diesem Bereich offen diskutieren will, wer darüber nachdenken möchte, was an Aufbewahrung und Aufarbeitung der Vergangenheit in Zukunft überhaupt noch zu leisten ist und welche Einschränkungen deshalb nötig sein könnten, muss auch die Risiken sehen, die eine solche Entscheidung mit sich brächte.
Er muss sich daran erinnern, dass sich die Nationalsozialisten aus anderen Gründen angemaßt haben, über werte und unwerte Kulturgüter zu entscheiden und mit der Vernichtung ihrer kulturellen Zeugnisse auch die physische Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen, vor allem der europäischen Juden, zu begründen und zu beginnen.
Er muss sich die Frage stellen, wer nach welchen Kriterien über Erhalt und Verfall entscheiden kann, wo Grenzen gesetzt werden und wie weit er gehen will, etwa bei den Baudenkmälern.
Es gibt zum Beispiel keinen wirklichen Grund dafür, die schlechte, monumentale, eklektizistisch-stillose Funktions- und Repräsentationsarchitektur aus der Zeit des Nationalsozialismus auch weiterhin der Öffentlichkeit zuzumuten. Das Gauforum in Weimar, die Ordensburg Vogelsang in der Eifel, das Luftfahrtministerium in Berlin — all diese Orte einstiger Machtdemonstrationen wären für die Gesellschaft der Moderne gut verzichtbar. Als Gedenkstätten entfalten nur wenige von ihnen eine nachhaltige Wirkung, weil sich die hier geplanten oder organisierten Verbrechen zwei Generationen später, bei völlig anderer Nutzung der Gebäude und ohne noch lebende Zeitzeugen, trotz bemühter Gedenkkonzepte kaum mehr nachfühlen lassen. Ganz anders an den Orten der ehemaligen Konzentrationslager oder in den Folterkellern von SS, SA und Gestapo. Wer vor den ehemaligen Krematorien steht, spürt die Ungeheuerlichkeit dessen, was hier geschah. Diesen Eindruck kann nur der wirkliche Ort vermitteln.
Wer eine Diskussion über die Zukunft unserer Archive, Bibliotheken und Museen anstoßen will, darf vor allem einen ganz und gar irrationalen Aspekt nicht außer Acht lassen: die Aura des Originals, die unsere Kultur der Bewahrung und Erinnerung bis heute prägt. So wie die philologisch hervorragende dtv-Edition nie auch nur annähernd den Zauber vermitteln wird, den die einzigartigen Liebes- und Sehnsuchtsgedichte von Else Lasker-Schüler in den heute brüchigen Erstausgaben ihrer Verleger Kurt Wolff und Paul Cassirer entfalten, so wird es auch mit einem Goethe-Autograph, einem John Cage-Tonband oder einer Taschenuhr sein, die Peter Henlein noch selbst gebaut hat. Oder mit jenen Dokumenten, die an Millionen ermordeter Menschen erinnern, deren Namen nur noch auf Papier überliefert sind. Hier stellt sich die Frage nach Erhalt oder Verfall nicht.