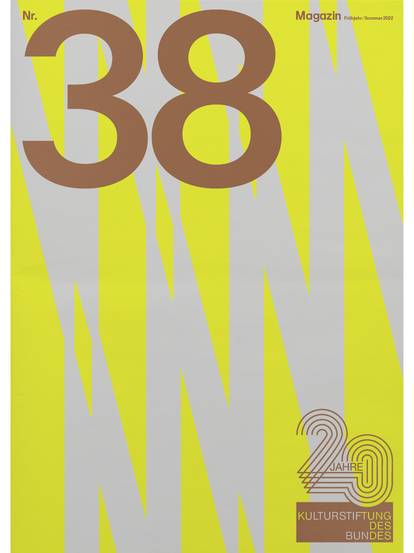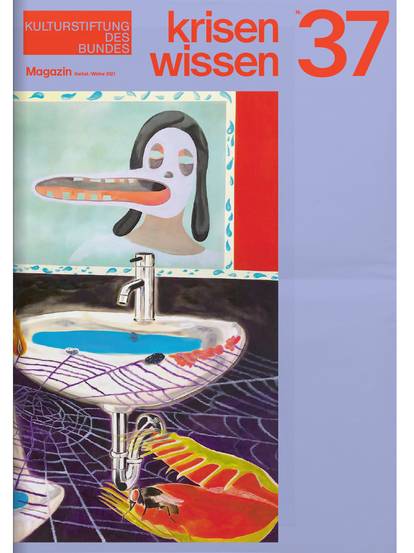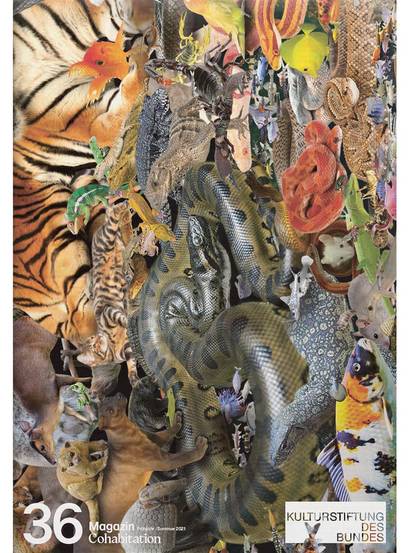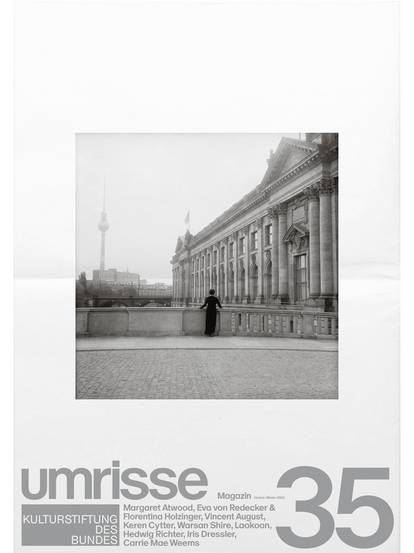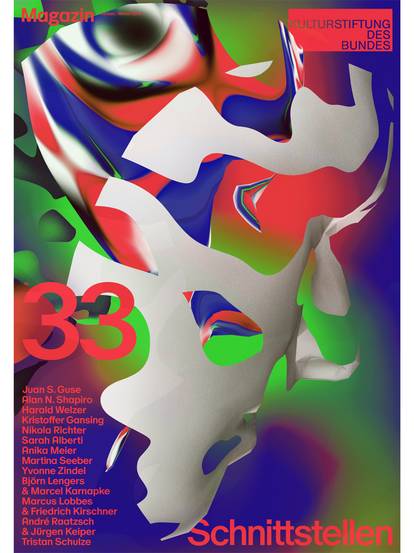Zwanzig Jahre nach dem Holocaust verschrieb sich Axel Springer (1912–1985) einer pro-israelischen Haltung, die ein persönliches Anliegen für ihn wurde. Wie kam er dazu und wie war seine Haltung zu Israel und den Juden? Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Ausstellung BILD Dir Dein Volk – Axel Springer und die Juden, die diesen Fragen nachgeht. Die Ausstellung behandelt das deutsch-israelische Verhältnis, wie es aus der Perspektive der größten deutschen Boulevard-Zeitung thematisiert worden ist. Die BILD-Zeitung hat einen Prozess beschleunigt, so die These der Ausstellung, der bis heute zu den bemerkenswertesten Vorgängen der deutschen Nachkriegsgeschichte gehört. Springers Philosemitismus war aber nicht zuletzt den Linken der 68er Generation ein Dorn im Auge. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar beleuchtet im Folgenden die ideologischen Konstellationen einer prekären Gegnerschaft zwischen dem Medienmogul und der linken Polit-Szene.
In der Rangliste linker Hassobjekte rangiert der vor einem Vierteljahrhundert verstorbene Verleger Axel Springer immer noch ziemlich weit oben. Das hängt nicht nur, aber auch – und zwar nicht zuletzt – mit dessen Verhältnis zu Israel, dem Judentum und den Juden insgesamt zusammen. Als die RAF im Mai 1972 in Hamburg einen Bombenanschlag auf das Springer-Hochhaus verübte, wurde das unter anderem damit begründet, dass der Verleger »seine propagandistische und materielle Unterstützung für den Zionismus – die imperialistische Politik der herrschenden Klasse Israels« einstellen solle. Verfasserin der Botschaft war die Ex-Journalistin und von nicht wenigen immer noch als linke Ikone angesehene Ulrike Meinhof.
Es kann nicht überraschen, dass bereits damals erhebliche Anstrengungen unternommen worden sind, Springer als insgeheimen Nazi und Antisemiten zu entlarven. Insbesondere in jenem Teil der außerparlamentarischen Linken, der sich mit der DDR als dem vermeintlich antifaschistischen Staat identifizierte, wurde mit einem nicht unerheblichen Aufwand versucht, braune Flecken in Springers Biografie ausfindig zu machen. So schrieb etwa der spätere Kabarettist Martin Buchholz 1970 im Berline r Extra-Dienst in höhnischem Tonfall: »Der bundesrepublikanische Chef-Wiedergutmacher, der sich schon 1933 mit Hakenkreuz-Armbinde und NSKK-Uniform als strammer Jung- Nazi ablichten ließ, ist in philosemitischen Enthusiasmus verfallen, seit die Israelis 1967 den Deutschen zeigten, wie man auch ›mit unseren Arabern‹ fertigwerden kann.« Auf dem Titelbild wurde der Leserschaft obendrein gezeigt, wie der 21jährige unter den Mitarbeitern der Bergedorfer Zeitung als einziger in NSUniform zu sehen ist. Aber dieser Eindruck täuscht.
Denn Springer war, nach allem, was bislang über seine Biografie bekannt geworden ist, weder ein Nazi noch ein Antifaschist, am ehesten war er ein Unpolitischer. Allerdings scheint er – wie etwa die Fälle des ehemaligen SS-Sturmbannführers Giselher Wirsing und des völkisch eingestellten, langjährigen Welt -Chefredakteurs Hans Zehrer beweisen – keinerlei Bedenken gehabt zu haben, ehemals überzeugte Nazis und Antisemiten in Organen seines Verlags schreiben zu lassen oder gar sie einzustellen und ihnen wichtige Aufgaben anzuvertrauen. Das mag zu Bedenken Anlass geben, berechtigt aber nicht dazu, Springer zum Objekt der eigenen Vorurteilsbildung zu missbrauchen und über ihn Pauschalurteile zu fällen.
Von dem einstigen Bundespräsidenten Gustav Heinemann stammt der bedenkenswerte Satz, wer mit ausgestrecktem Zeigefinger auf jemanden deute, der solle immer daran denken, dass in derselben Hand zugleich drei andere Finger auf ihn selbst zurückweisen würden. Dieser Gedanke könnte vielleicht auch für das spannungsgeladene Verhältnis zwischen Axel Springer, seinem Verlag und dessen Publikationen auf der einen und der Linken auf der anderen Seite Gültigkeit besitzen.
I.
Das Wort Antisemitismus ist zweifelsohne eine scharfe Klinge. Aus naheliegenden Gründen gilt das für Deutschland mehr als für jedes andere Land. Wer hier als Antisemit entlarvt werden kann, der ist in der Öffentlichkeit so gut wie erledigt. Um einen derartigen Vorwurf nicht nur vorbringen, sondern ihn auch aufrechterhalten zu können, bedarf es jedoch einer eindeutigen, möglichst unwiderlegbaren Klarheit der Fakten. Doch genau daran mangelt es häufig. Wenn erst einmal – wie zuletzt im Zusammenhang mit einer Partei, die die Stirn hat, sich usurpatorisch als »Die Linke« zu bezeichnen – ein Streit um einen tatsächlichen oder vermeintlichen Antisemitismus ausgebrochen ist, dann stellt sich nur allzu oft der Eindruck eines Unbehagens ein.
Was stimmt an dem vom Zentralrat der Juden vorgebrachten Vorwurf, in dieser Partei würde ein »geradezu pathologischer, blindwütiger Israel-Hass« ausgelebt? Eine Reihe von Indizien, die eindeutig in diese Richtung gehen, sind gewiss nicht von der Hand zu weisen. Die Bundestagsabgeordnete der ›Linken‹, Inge Höger, war etwa auf einer Palästina-Konferenz mit einem Schal aufgetreten, auf dem eine Karte des Nahen Ostens abgebildet war, in der es kein Israel mehr gab. Und der Duisburger Kreisverband der Partei hatte auf seiner Homepage zu einem Boykott israelischer Waren aufgerufen und zudem ein Logo verbreitet, in dem der Davidstern eine Symbiose mit dem Hakenkreuz eingegangen war. Reicht das jedoch aus, um behaupten zu können, dass in der aus einem Zusammenschluss von PDS und WASG hervorgegangenen Organisation israel- und judenfeindliche Positionen »innerparteilich immer dominanter« würden? Das jedenfalls ist das Ergebnis einer von zwei Sozialwissenschaftlern der Universitäten Gießen und Leipzig verfassten Studie. Könnte das aber nicht nur Munition für den ohnehin üblichen Streit zwischen Parteien sein, die einen unliebsamen Konkurrenten auf Distanz halten wollen? Der Antisemitismusvorwurf eingesetzt als probates Mittel der Diskreditierung?
In der jüngeren Vergangenheit ist sogar von einem »alarmistischen Anti-Antisemitismus« gesprochen worden. Gemeint ist damit, dass das, was er zu bekämpfen vorgibt, überhaupt erst konstruiert werde. In Schutz genommen werden sollen damit offenbar vor allem Exponenten der Linken. Während Alarmsignale in Richtung auf die Rechte durchaus angemessen seien, lautet die kaum kaschierte Botschaft, wären sie auf Seiten der Linken unangebracht. Im »Anti-Antisemitismus« würde sich häufig nichts anderes als ein Alarmismus äußern, nach Möglichkeit in jedem x-beliebigen Fall Alarm zu schlagen. Im Grunde gehe es nicht nur darum, ein ubiquitäres Feindbild zu konstruieren, sondern damit letztlich einen Popanz aufzubauen.
Diese Haltung ist von jener nicht sonderlich weit entfernt, mit der Martin Walser 1998 bei seiner denkwürdigen Dankesrede für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche hervorgetreten war. Er sprach damals von der »Auschwitz-Keule«, mit der angeblich auf die Deutschen eingeprügelt werde. Ignatz Bubis, der seinerzeitige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, hatte den Preisträger deshalb als »geistigen Brandstifter« beschimpft und damit – obwohl er diesen Vorwurf schon bald darauf zurückzog – eine Debatte über die Maximen einer Erinnerungs- und Gedenkkultur in Deutschland ausgelöst.
II.
Doch wie definiert sich linker Antisemitismus und woran lässt sich seine Virulenz erkennen? Wie lauten die Kriterien, um die Virulenz eines als linker Antisemitismus klassifizierten Phänomens bestimmen zu können? Einerseits geht es ja um eine objektivierbare Vorurteilsstruktur, andererseits aber um deren Verdecktheit – ein Phänomen, das zumeist nicht unmittelbar, sondern häufig nur indirekt und undeutlich hervortritt. Die Diagnose wird nicht zuletzt zu einer hermeneutischen Aufgabe.
Wie lässt sich den naheliegenden ideologischen Fallstricken entgehen und analytisch größere Klarheit gewinnen? Diese Frage zielt vor allem auf das Verhältnis von Implikation und Explikation ab. Und dahinter wiederum steht das Problem der Entkoppelung von Begriff und Phänomen, der tendenziellen Entgrenzung des Begriffsgebrauchs und der Gefahr pauschalisierender Schlussfolgerungen.
Kritik an einer Nation ebenso wie an der Gründungsidee zum Aufbau einer Nation mag legitim erscheinen, zumal dann, wenn dieser Prozess vor allem auf Kosten der dort ansässigen Bevölkerung – in diesem Fall den Palästinensern – gegangen ist und noch immer geht. Die Gegner- bzw. Feindschaft gegenüber Israel, den Juden inner- wie außerhalb Israels sowie dem Judentum in seiner Gesamtheit erfüllt dagegen die Kriterien für eine klassische Vorurteilsbildung. Entscheidend ist deshalb eine genauere Bestimmung des Verhältnisses von Antizionismus und Antisemitismus. Insbesondere ist zu fragen: Verbirgt sich im Antizionismus nur ein politisch ummäntelter Antisemitismus? Und wenn ja: Wie hoch ist der Grad an Antisemitismus, der sich im Antizionismus versteckt? Das Hauptaugenmerk muss deshalb darauf gelegt werden, diese Relation genauer auszuloten.
Die seitens verschiedener Strömungen der Linken immer wieder verwendete Verteidigungsformel lautet: Antizionismus als solcher sei legitimationsfähig und nicht, jedenfalls nicht umstandslos – wie das der Lyriker Erich Fried bereits 1973 angemahnt hat – mit Antisemitismus gleichzusetzen. Die sich als antiimperialistisch begreifende Linke dürfe sich, wird immer wieder betont, das Recht auf eine grundlegende Kritik am Staat Israel und dessen Wurzeln in der zionistischen Ideologie nicht nehmen lassen. Und wer dennoch behaupte, dass der Antizionismus mit dem Antisemitismus gleichgesetzt werden könne, der führe – wie von der Springer- Presse immer wieder vorgemacht – nichts anderes im Schilde, als die Linke zu diskriminieren. So lautet im Übrigen auch der Vorwurf gegenüber der Partei gleichen Namens.
Wie weit handelt es sich dabei nun aber um das Insistieren auf einer sachlichen Differenz oder aber nur um eine wortreich in Szene gesetzte Camouflage? Der vor wenigen Monaten im Alter von über hundert Jahren verstorbene niederländische Psychoanalytiker Hans Keilson hat dazu eine ganz eindeutige Haltung. Für ihn ist die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antizionismus nichts anderes als eine linguistische Finte, eine Argumentationsfalle, die vor allem dazu diene, Aggressionspotentiale bei Ausklammerung des tabuisierten Wortes »Jude« b z w. »jüdisch« politisch ausbeuten zu können.
Die Tatsache, dass es so lange gebraucht hat, bis überhaupt möglichen Zusammenhängen zwischen Antizionismus und Antisemitismus nachgegangen worden ist, liegt vermutlich darin begründet, dass die Linke geglaubt hat, durch ihre antifaschistische Gesinnung antisemitischen Tendenzen gegenüber per se gefeit zu sein. Der Schriftsteller Gerhard Zwerenz war seinerzeit sogar davon überzeugt, wie er 1976 in der Wochenzeitung Die Zeit postulieren durfte, dass sich Antisemitismus und Linkssein kategorisch ausschließen würden. Der Publizist Henryk M. Broder war einer der ersten, der auf diese politische Lebenslüge hingewiesen hat. Die gesellschaftliche Wirksamkeit antisemitischer Stereotypen beschränkt sich gerade nicht auf bestimmte politische Lager. Sie tauchen in der Rechten wie der Linken und – wie nicht vergessen werden sollte – ebenfalls in der Mitte auf. Auch die beiden Volksparteien sind nicht gänzlich davor gefeit.
III.
Ein Blick zurück kann zeigen, warum es in der alten Bundesrepublik überhaupt zum antisemitischen Verdacht gegenüber Linken gekommen ist. Das hängt vor allem mit einer historischen Zäsur zusammen, dem von Israel gewonnenen Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967, einem Krieg, von dem Springer später scherzhaft erzählte, dass er für sechs Tage aus den Blättern seines Verlages israelische Zeitungen gemacht habe, allerdings ohne sie auf hebräisch erscheinen zu lassen, weil das dem Verkauf zu abträglich gewesen wäre. Danach, nach dem Juni 1967, erschien das Land, das den Opfern des Holocausts mehr als nur Zuflucht geboten hatte, vielen als Aggressor und Eroberer. Aus Opfern schienen nun plötzlich selbst Täter geworden zu sein. Unter dem Eindruck dieses gewandelten Bildes hatte sich die Einstellung vieler Linker, insbesondere aber des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), Israel gegenüber schlagartig verändert. Die pro-israelische Haltung verschiedener linker Studentenorganisationen, die sich bis dahin in zahlreichen Kontakten, insbesondere Besuchsdelegationen und Kibbuz-Aufenthalten, niedergeschlagen hatte und zum Teil auch in Israel selbst jahrelang als Vorreiter für eine Politik der Aussöhnung verstanden worden war, wich genau in der Zeit, in der sich, ausgelöst durch die tödlichen Schüsse auf Benno Ohnesorg, eine bundesweite Studentenbewegung herauskristallisierte, einer mehr als nur kritischen, häufig grundsätzlich ablehnenden, sich mehr und mehr in einer einseitigen Parteinahme für die Sache der Palästinenser manifestierenden Position.
So wie mit dem SDS die Hochschulgruppe der SPD seit Anfang der fünfziger Jahre eine Vorreiterrolle für die Wiedergutmachung der Nazi-Verbrechen am jüdischen Volk und die Anerkennung des Staates Israel gespielt hatte, so nahm sie nun – nachdem sie 1961 aus der Mutterpartei hinausgeworfen worden war – die Aufgabe einer Avantgarde für die um staatliche Unabhängigkeit kämpfenden Palästinenser wahr. Für den Positionswechsel gab es zwei vordergründig rationalistische Argumentationsfiguren: Die Kritik an dem in der frühen Bundesrepublik besonders ausgeprägten Philosemitismus als einer bloß reaktiven Antwort auf den Antisemitismus und die Einbeziehung Israels, das immer ausschließlicher als machtpolitischer Vorposten der USA im Nahen Osten angesehen wurde, in die klassische Imperialismuskritik der Linken.
Seit dem Sommer 1967 lauteten die entsprechenden Stichworte zur Charakterisierung der israelischen Politik: Aggression und Expansion. Zionismus wurde unter Abstrahierung von seinen historischen Entstehungsbedingungen mit Kapitalismus, Kolonialismus und Imperialismus gleichgesetzt. Das war eine an Eindeutigkeit kaum noch zu überbietende Feinderklärung an den Staat Israel und die dort lebenden jüdischen Bürger. Hier lag bereits in Grundzügen das Repertoire vor, das, mit einem marxistischen Vokabular pseudo-theoretisch aufgeladen, mit dazu beigetragen hat, einen nur notdürftig ummäntelten linken Antisemitismus möglich werden zu lassen. Unter dem Schutzschild abstrakter Großkategorien, die eine programmatische Herrschaftskritik zu verbürgen schienen, beabsichtigte man, sich gegen naheliegende Vorwürfe, dass es beim Antizionismus in Wirklichkeit um nichts anderes als die Wiederauferstehung des Antisemitismus gehe, immunisieren zu können. Im Kern ging es aber darum, Israel das Existenzrecht zu verweigern. Diese Weigerung steht insgeheim im Zentrum aller Varianten des Antizionismus.
IV.
Rückblickend sind es mehrere Stationen gewesen, die im Laufe eines knappen Jahrzehnts, genauer in den Jahren von 1967 bis 1976, einen grundlegenden Positionswandel markiert haben. Die antizionistische Ausrichtung bildete zunächst das einheitsbildende und kontinuitätsstiftende Grundelement. Sie durchlief dabei aber ganz unterschiedliche Aggregatzustände. Sie ging zunächst von einer pauschalen Israel-Kritik im SDS aus, der einst wichtigsten Organisation der radikalen Linken, schälte sich innerhalb der Westberliner Subkultur als antijüdische Anschlagspraxis heraus, manifestierte sich am 9. November 1969 im Bombenanschlag auf das Jüdische Gemeindehaus in der Form eines zwar missglückten, aber offenbar doch intendierten Terroraktes, nahm mit der RAF eine dauerhafte Kooperationsbeziehung mit strikt antiisraelisch eingestellten Terrorgruppen wie denen der Palästinenser an und rückte 1976 in Entebbe mit der von den Revolutionären Zellen im Zusammenhang mit einer Flugzeugentführung durchgeführten Selektion jüdischer Geiseln in die Nähe des von den Nazis praktizierten eliminatorischen Antisemitismus. Als Axel Springer, der sich genau zu dieser Zeit zufällig in Jerusalem aufhielt, von dem geglückten israelischen Kommandounternehmen zur Befreiung der Geiseln hörte, ging er nachts um halb eins in die Lobby des King David-Hotels und legte dort – nur mit einem Schlafrock bekleidet – vor Erleichterung einen Freudentanz hin.
Während sich zum einen das judenfeindliche Moment immer schärfer herauskristallisiert hatte, war das Bezugsfeld zunehmend geschrumpft. So verbreitet die Israel-Kritik und der Antizionismus als Weltanschauung einerseits auch waren, so wollten andererseits doch nur wenige mit unmittelbaren Angriffen auf Juden und Anschlägen auf jüdische Einrichtungen etwas zu tun haben. Je mehr sich der antijüdische Kurs verfestigte, umso stärker isolierten sich deren Protagonisten. Gerade weil sich der Antizionismus nicht in antisemitischen Formen einer auch weiterhin öffentlich agierenden Bewegung zuspitzen und funktionalisieren ließ, wurde der Kern dieser judenfeindlichen Tendenz in den Untergrund der sich in ihrer Formationsphase befindlichen bewaffneten Gruppierungen abgespalten und vermochte sich dort in terroristischen Praxisformen zunehmend zu etablieren.
V.
Wie lässt sich nun aber der radikale, im Sommer 1967 vollzogene Wandel von entschiedenen Israel-Befürwortern zu expliziten Israel-Gegnern sowie Parteigängern der Palästinenser und seine Zuspitzung neun Jahre später im Menetekel von Entebbe überhaupt erklären? Wie ist vorstellbar, dass aus erklärten Antifaschisten im Handumdrehen überzeugte Antizionisten, wenn nicht gar Antisemiten werden konnten?
Als rätselhaft muss vor allem ein doppelter Vorgang erscheinen: Zunächst die emphatisch vollzogene Hinwendung zu den Ländern der Dritten Welt und die damit einhergehende Glorifizierung nationalrevolutionärer Guerillaorganisationen, dann die Wahl des Nahostkonflikts als zentraler Krisenregion und die damit verbundene Identifikation mit den verschiedenen palästinensischen, als Befreiungsbewegungen idealisierten Terrororganisationen. Mit dieser doppelten Wahl wurden zwei Ausblendungen vollzogen: Zum einen die als tabuisiert angesehene Frage der deutschen Nation und zum anderen die für die deutsche Spaltung verantwortliche Blockkonfrontation zwischen Ost und West. Beide Aussparungen, die für das Selbstverständnis einer westdeutschen Linken hätten zentral sein müssen, haben ihre Wurzel in der NS-Vergangenheit und der auf den Trümmern des Nationalsozialismus errichteten Nachkriegsordnung. Sie waren offenbar so massiv, dass sie durch den Internationalismus im Allgemeinen und die Identifikation mit den Palästinensern im Besonderen überblendet werden mussten.
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Korrelation zwischen Antiimperialismus und Antizionismus. Als 1972 etwa der RAF-Begründer Horst Mahler von einer »Symbiose zwischen Zionismus und Imperialismus« sprach, gab er Israel im Grunde zum Angriff frei. Zumindest in dieser Hinsicht kann es nicht verwundern, dass aus dem einstigen Linksterroristen später ein überzeugter Faschist hat werden können. Auf einer supranationalen Ebene ging es um die Herrschaft des Kapitals, die Ausbeutung und die Verfügung über das Geld. Mit Israel – so wurde suggeriert – habe die Figur des »Geldjuden« eine staatliche Form angenommen. Der jüdische Staat wurde nun als Statthalter des imperialistischen Systems im Nahen Osten betrachtet.
Darin aber spiegelt sich das alte antisemitische Klischee wider – der jüdische Repräsentant des internationalen Kapitals hat danach einen Staat errichtet, um die Vormachtstellung des US-Imperialismus zu sichern und weiter auszubauen. Der Gedanke, dass der seit Gründung 1948 in seiner Existenz fortwährend bedrohte Staat Israel seine Verteidigung organisieren muß, hat hier keinen logischen Ort mehr. Der Topos vom »zionistischen Imperialismus «, der in seiner Wirksamkeit auf fatale Weise aktuell geblieben ist, erfüllt die Kriterien einer wahnhaften Ideologie. Unter dem vermeintlichen Schutz marxistisch-leninistischer Kategorien wird damit implizit an die antisemitischen Klischees der NS-Zeit angeknüpft und ein längst in Abrede gestellter Wirkungszusammenhang zwischen NS- und Nachkriegsgeneration wieder hergestellt. Bei alldem spielen psychologische Faktoren eine große Rolle. Die Solidarisierung mit den Palästinensern etwa bot jungen Deutschen die Möglichkeit, die Verbrechen des eigenen Landes entweder zu neutralisieren oder aber ganz zu überblenden. Je martialischer Israel bei seinen militärischen Aktionen in Erscheinung trat, umso leichter wurde es und ist es noch immer, das Land als solches als Aggressor abzustempeln und die Erinnerung an den Holocaust und die jüdischen Opfer in den Hintergrund zu drängen. Das alles hat für die Generationen der Nachgeborenen zweifellos eine entlastende Funktion. Daher ist es auch so verbreitet, Israel mit dem NS-Regime und sein Militär mit der Deutschen Wehrmacht oder gar der SS auf eine Stufe zu stellen. Im Zentrum der Palästinabegeisterung könnte so eine heimliche Selbstrechtfertigung stehen, nach dem Motto: Seht her, was in unserem eigenen Namen an Verbrechen begangen worden ist, kann so schlimm nicht gewesen sein, wenn das Land, das die Opfer des Holocausts als Kollektiv vertritt, selbst Verbrechen begeht.
In der Psychoanalyse, die besonders eingehend Abwehrmechanismen, die dem Subjekt zur Bewältigung innerer Konflikte zur Verfügung stehen, untersucht hat, ist deshalb auch von einer Verschiebung die Rede. In ihrem Erkenntnismodell gehört die Abwehr zu den Ich-Funktionen. Mit ihr sollen unlustvolle und angsterzeugende Vorgänge aus dem eigenen Bewusstsein verbannt werden. Damit wird eine Auseinandersetzung mit den Ursachen eines Konflikts umgangen und notdürftig ein Gleichgewicht im Affekthaushalt hergestellt. Um sich etwa von Schuld- und Schamgefühlen zu entlasten, stehen dem Ich verschiedene Techniken wie Verdrängung, Verleugnung, Abspaltung, Projektion und eben Verschiebung zur Verfügung.
Indem die von der Elterngeneration begangenen Verbrechen allein schon ihrer quantitativ wie qualitativ schier unermesslichen Dimension wegen die psychische Stabilität ihrer heranwachsenden Kinder gefährdeten, suchten diese zu einem Zeitpunkt nach Möglichkeiten, ihre Schuldgefühle auf andere abzuwälzen, als sie ihre eigenen Ich-Ideale ausbildeten. Eine in dieser Hinsicht einzigartige Gelegenheit bot sich Teilen der jungen Generation, als Israel in ihren Augen 1967 an den Palästinensern Unrecht beging. Damit konnte man dem Repräsentanten der Opfer etwas von jener Schuld aufbürden, die auf den Schultern der Eltern lastete und ihre Nachkommen so sichtlich überforderte.
In der Figur der Palästinenser bot sich zugleich ein Objekt der projektiven Identifizierung. Sich an ihre Seite zu stellen war so etwas wie der geheime Garant der eigenen Entlastungsfunktion. Nicht umsonst hatte sich die damalige Neue Linke wie von einem inneren Magnetismus getrieben – als hätte es keine naheliegenderen Herausforderungen gegeben – auf den Nahostkonflikt kapriziert, sich mit den Palästinensern, insbesondere ihren aggressivsten Organisationen, identifiziert und die Wurzel aller aufgetretenen Probleme bei den Israelis diagnostiziert. So konnten unverarbeitete psychische Probleme zum Motor eines vermeintlich politischen Projekts werden. Beim vielbeschworenen Frieden im Nahen Osten dürfte es aus dieser Sicht wohl in erster Linie um den inneren Frieden deutscher Aktivisten gegangen sein.
VI.
Axel Springer war für die Linke – und ist es zum Teil noch immer – so etwas wie ihr Erzfeind. Er erschien wie eine negative Idealfigur des Establishments, mit dem vollständigen Wertekanon der 50er Jahre und einer überaus resistenten ›Heile Welt‹-Ideologie. In Springers Person bündelte sich all das, wogegen die radikale Linke in der Bundesrepublik war: der Antitotalitarismus, der Pro- Israelismus, der Pro-Amerikanismus, das Festhalten an der deutschen Einigung und die Verteidigung des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Die Zerschlagung des von ihm geschaffenen Medienimperiums galt lange Zeit als Schlüssel dafür, die »Manipulation « der lohnabhängigen Massen zu verhindern und sie statt dessen selbst zum Objekt einer revolutionär gesinnten Agitation machen zu können. In der linken Fantasie schien zwischen der politischen Apathie der Massen und ihrer klassenkämpferisch ausgerichteten Mobilisierung vor allem dieser zwar mächtige, von seinem Habitus her aber eher moderat eingestellte Mann zu stehen. Vor allem deshalb war er so verhasst.
Doch es gibt bei allen Differenzen auch einige Punkte, die Springer auf eine eigentümliche Weise mit der einstmals radikalen Linken verbinden. Der SDS etwa war bis 1967 philosemitisch eingestellt und Axel Springer begann genau zum selben Zeitpunkt, sich diese Haltung zu eigen zu machen. Es war fast so, als habe er damit einen Staffelstab übernommen und ihn dabei nur von der linken in die rechte Hand gelegt. Und mit Rudi Dutschke ließ sich der unbestrittene Wortführer der damaligen APO, der kurz vor dem Mauerbau aus der DDR geflohen war, in seiner Gegnerschaft zur SED nur schwer überbieten. Hätte Springer damals geahnt, dass Dutschke ebenso wie er ein unerschütterlicher Verfechter der Wiedervereinigung Deutschlands war, dann wäre es vielleicht nicht ganz undenkbar gewesen, dass er ihn zu einem Gespräch eingeladen hätte und manches vielleicht etwas anders gelaufen wäre. Sein Sohn, der sich am Tag von Dutschkes Beerdigung das Leben nahm, hatte dessen Frau und Kinder zeitweilig sogar materiell unterstützt. So scheint es bei aller Gegnerschaft auch eine tragische Dimension zu geben, die untergründig verbindet. Und das gilt vielleicht auch für das Verhältnis zu Israel und den Juden.