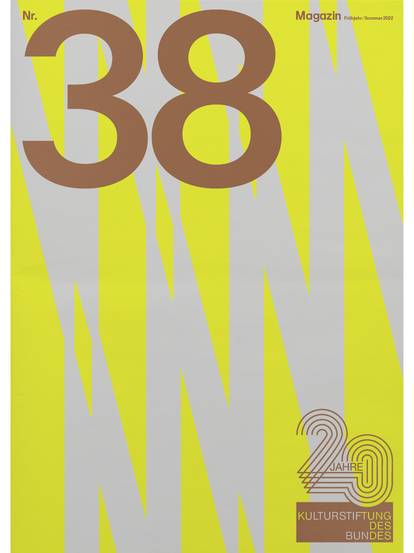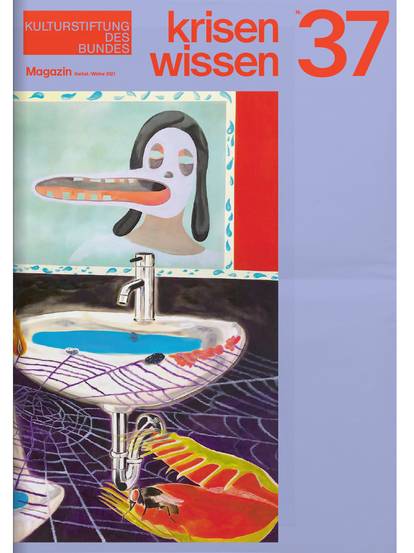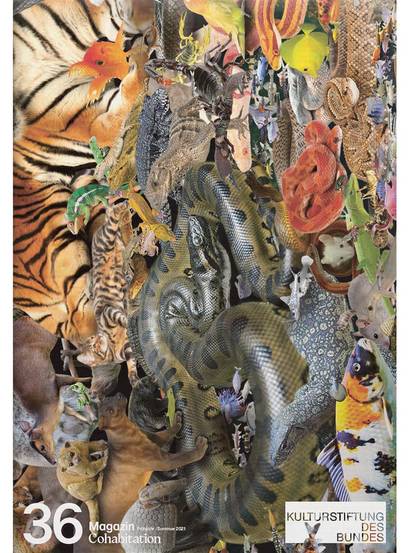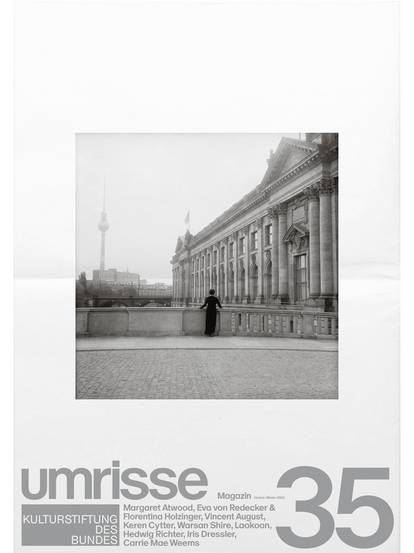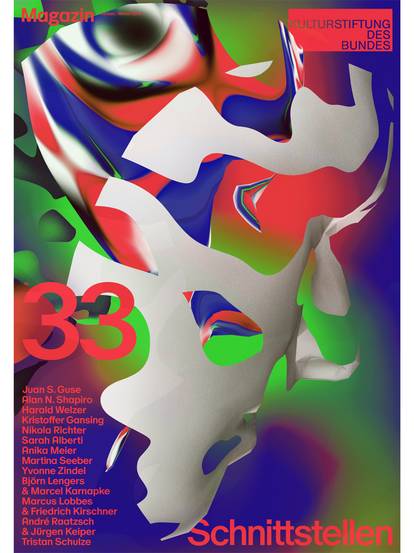Cohabitation von Erinnerungskulturen I: Die Historikerin Mirjam Zadoff beklagt eine unzureichende Berücksichtigung von Diversität bei der Aufarbeitung der Vergangenheit und ihre Folgen für die Gegenwart.
Nichts ist geblieben von der größten Propaganda- Ausstellung des Dritten Reiches. Was sollte auch bleiben? Gips, Papier, Sperrholz – viel mehr war nicht dahinter, als im November 1937 die angeblich „größte Ausstellung Europas“ eröffnete: Unter dem Titel „Der ewige Jude. Grosse politische Schau“ inszenierte das Münchner Deutsche Museum auf 3500 Quadratmetern und in 20 Sälen hetzerischen Antisemitismus in Objekten, gefälschten Statistiken, ins Monströse vergrößerten Fotos und angstmachenden Weltkarten. Ein begeisterter Goebbels reiste an, Schulklassen wurden zwangsverpflichtet, über 5000 Besucher* innen kamen jeden Tag. Die Ausstellung wanderte weiter nach Wien, Berlin, Bremen, Dresden und Magdeburg und wurde von über einer Million Menschen gesehen. Eine ähnliche Schau wurde im Herbst 1941 im besetzten Paris einem französischen Publikum vorgesetzt.
„So hat diese absolut objektive, fast leidenschaftslose Ausstellung den Zweck, jedem die Augen zu öffnen anhand unwiderlegbarer Dokumente“, lobte der Völkische Beobachter die Arbeit der Kuratoren und Wissenschaftler. Zu diesen objektiven Dokumenten zählten: Nasen, riesenhaft vergrößerte Nasen, Münder und Ohren, groteske Karnevalsobjekte in musealen Glasvitrinen. Dazwischen fanden sich, kleiner und fast schon unscheinbar, Gipsmasken deutscher Jüdinnen und Juden – in Konzentrationslagern angefertigte Lebendmasken, mit denen deportierte und gequälte Menschen in Ausstellungsobjekte transformiert wurden.
Die Tradition der Lebendmasken reicht zurück bis ins späte 19. Jahrhundert, als in der deutschen Kolonie Papua-Neuguinea Gipsmasken der indigenen Bevölkerung angefertigt wurden, die man später kolorierte und im Berliner Wachsfigurenkabinett ausstellte. Diese koloniale Technik, Gesichter in Objekte für die Wissenschaft zu verwandeln, wurde bald von der Fotografie abgelöst. Nicht zufällig holten Nazi-Kuratoren diese koloniale Praxis 1937 zurück ins Museum – es galt, aus Deutschen Fremde zu machen, aus bekannten Gesichtern „Unzivilisierte“, aus Vertrauten Feinde. Material und Technik sollten visualisieren, was die Propaganda täglich in ihren Slogans und Hetzreden wiederholte: dass es Deutsche gab, denen alles zustand, und solche, denen alles abgesprochen wurde – auch das Deutschsein und die damit verbundenen Rechte [Mirjam Zadoff, Der rote Hiob. Das Leben des Werner Scholem, München 2014].
Die Weimarer Republik war zweifelsohne eine problematische, fehlerhafte und fragile Demokratie gewesen – aber sie war näher an einer offenen, vielfältigen Gesellschaft als alles, was Deutschland bis dato erlebt hatte. Weimar brachte Freiheiten und ein neues Selbstverständnis für Frauen, Minderheiten und eine bis dahin weitgehend stumme Jugend. Dieses rasche und wilde Aufblühen gesellschaftlicher Diversität wurde 1933 mit allen Mitteln aus dem öffentlichen Leben entfernt, Museen und Bibliotheken wurden von ihr gesäubert, ihre Vertreter*innen unterdrückt und verfolgt. An Stelle der Vielfalt rückte eine imaginierte „Volksgemeinschaft“, weiß, homogen, nationalistisch, antisemitisch – eine Gesellschaft, die angeblich die Kontinuität deutscher Kultur und Tradition repräsentierte und dabei die Geschichte der modernen Migration ungeschrieben machen wollte.
Die meisten Jüdinnen und Juden, die 1933 zu Fremden und Feinden erklärt wurden, lebten seit Generationen in Deutschland. Um ihre Isolation, Beraubung und Verfolgung zu rechtfertigen, bediente man sich alter antisemitischer Feindbilder und vermischte sie mit (anti)modernen Verschwörungsmythen und pseudowissenschaftlicher Rassenforschung. Um eine Gesellschaft, die durch Freundschaften, Ehe- oder Geschäftspartnerschaften ineinander verwoben war, entlang rassistischer Vorstellungen zu segregieren, ließen sich die Nazis von der deutschen Kolonialgeschichte inspirieren; in Namibia etwa waren zur Zeit des Kaiserreichs Forschungen zur „Rassentrennung“ bzw. „-vermischung“ entstanden. Inspiration bot aber auch ein anderes westliches Land, das die Segregation seiner Bevölkerung praktizierte: In den USA verboten die „anti-miscegenation laws“ die Ehe zwischen Weißen und Schwarzen im Großteil des Landes bis 1948 (in den Südstaaten bis in die 1960er Jahre). Die „one-drop rule“ der Jim CrowÄra bestimmte weiters, dass ein Tropfen „schwarzen Blutes“ ausreichte, um einen Menschen „nicht-weiß“ zu machen und ihm damit alle Rechte und Privilegien Weißer abzusprechen [Quelle: New Yorker (externer Link, öffnet neues Fenster)].
Forschungen der letzten Jahre belegen, wie der Nationalsozialismus von solchen Formen der Segregation inspiriert wurde, ohne zu verhehlen, dass gleichzeitig andere Elemente des NS-Regimes, beginnend mit den ersten Konzentrationslagern und der innerhalb dieses Systems praktizierten Grausamkeit, durchaus Eigenerfindungen waren. Ohne die deutsche Schuld zu relativieren oder das radikal Böse der Nazis in Frage zu stellen, erinnern diese Einflüsse daran, dass der Nationalsozialismus nicht im luftleeren Raum entstanden war, sondern an Praktiken der Segregation, Ausgrenzung und Verfolgung anknüpfte, von antijüdischen Pogromen bis hin zur kolonialen Siedlungspolitik als Vorbild für die „Germanisierung“ Osteuropas – Referenzen, die von den Tätern selbst ins Spiel gebracht wurden. Warum eine Kontextualisierung und Sichtbarmachung solcher Kontinuitäten – und Brüche – zentral ist für Erinnerungsdiskurse, möchte ich an einem Beispiel erläutern.
Im Jahr 2020 war im Münchner NS-Dokumentationszentrum die (von der Kulturstiftung des Bundes geförderte) Ausstellung Tell me about yesterday tomorrow (öffnet neues Fenster) zu sehen. Über 50 teilweise eigens für die Ausstellung entstandene künstlerische Arbeiten stellten Fragen an die deutsche Erinnerungskultur oder brachten diese in einen Austausch mit anderen kulturellen und nationalen Diskursen über traumatische Vergangenheiten. Auch in den Räumen der historischen Dauerausstellung „München und der Nationalsozialismus“ waren einige gemeinsam mit dem Gastkurator Nicolaus Schafhausen mit Bedacht platzierte Arbeiten zu sehen, darunter „Entryways“ der amerikanischen Künstlerin Diamond Stingily: eine abgenutzte Holztür, an der ein Baseballschläger lehnt. Stingily thematisiert damit die Gewalt und Exponiertheit, die den Alltag von Afroamerikaner*innen und PoCs in Amerika prägen. Für die Künstlerin hat dieses Bild auch eine positive Konnotation, indem es an den geschützten Ort erinnert, den ihre Großmutter für ihre Enkelkinder geschaffen hat. In München war „Entryways“ umgeben von Fotos und Dokumenten zur Entsolidarisierung und Radikalisierung der Münchner Gesellschaft in den frühen 1920ern durch die junge NS-Bewegung und ihre Sympathisant* innen in Politik, Polizei und Justiz.
Als eine Gruppe amerikanischer Politiker* innen im Winter 2020 die Ausstellung besuchte, lösten dieses Objekt und seine Platzierung eine emotionale Diskussion aus: über den deutschen Umgang mit der eigenen Geschichte und über die Frage, welche Herausforderungen sich daraus für den amerikanischen Kontext ergeben. Die Trump-Präsidentschaft hat in Amerika heftige geschichtspolitische Debatten in Gang gesetzt, an denen sich ablesen lässt, wie zentral die Deutung von nationalen Vergangenheiten für die aktuelle Krise der Demokratie ist. In dem Gespräch der Politiker*innen miteinander fiel auch die Bemerkung, dass die Nazis das absolute Böse gewesen wären und deshalb mit nichts vergleichbar. Eine solche Charakterisierung der Täter als a-menschliche Monster ist nicht nur falsch, sondern auch bequem und damit gefährlich. Denn sowohl im Menschsein der Täter liegt die wahre Drastik und Dramatik als auch in den manchmal übersehenen Grauzonen der Geschichte: in der schleichenden Radikalisierung einer toleranten Gesellschaft; im Empathieverlust gegenüber Freunden, Nachbarn oder Kollegen, die plötzlich als Feinde wahrgenommen werden; in der Verantwortung der Ermöglicher und Unterstützer – im Fall Hitlers der Münchner Oberschicht und der Industrie; und natürlich in der Rolle der unscheinbaren Mitläufer, Profiteure und Stillhalter, die das Rückgrat des Regimes bildeten. Die Grauzonen sind es auch, aus denen die Relevanz und Notwendigkeit gesellschaftlicher Solidarität, Verantwortung und Zivilcourage spricht.
Was heute gern mit Stolz als Errungenschaften „deutscher Erinnerungskultur“ aufgezählt wird, verdanken wir in erster Linie den Überlebenden. Noch 1966 befürchtete Jean Améry, dass es für deutsche Jugendliche dereinst unmöglich sein werde, Goethe zu zitieren, aber Himmler auszulassen. Améry war einer von vielen Überlebenden, die schmerzhaft zu Zeugen der deutschen Verdrängung und Ignoranz der Nachkriegsjahre wurden. Sie waren es, die über Jahrzehnte einen widerständigen Kampf für das Erinnern geführt haben, und es dauerte bis in die 1980er und 90er Jahre, bis ihre Erzählungen endlich ein breites Publikum erreichten.
Ende der 1980er Jahre führte Saul Friedländer einen richtungsweisenden Briefwechsel mit Martin Broszat, dem Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Broszat vertrat die damalige Sicht der deutschen Zeitgeschichte, als er die Erinnerungen der Überlebenden zu „geschichtsvergröbernde[n] Mythen“ degradierte, die einer objektiven, auf den Hinterlassenschaften der Täter basierenden Wissenschaft gegenüberstünden. Den Täter*innen und ihren Nachkommen wurde damit größere Sachlichkeit und Neutralität zugesprochen als den Zeitzeug*innen und ihren Nachkommen. Friedländer, Überlebender und Professor für Geschichte in Israel und den USA, konterte und forderte eine „integrierte Geschichte“, die Täter- und Opferperspektiven verknüpfte und sich damit von einer Deutungshoheit der Täternation loslöste. [Martin Broszat/Saul Friedländer, Um die Historisierung des Nationalsozialismus, In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 36 (1988) 2, 339-372.] Friedländers Forderung nach einem multiperspektivischen Erinnern brachte einen damals längst fälligen Wandel im deutschen Nachdenken über die nationalsozialistischen Verbrechen – und sie kann als Vorbild dienen für die Aufarbeitung anderer Traumata, von rassistischer und kolonialer Unterdrückung. Seine Geschichte zeigt, wie wichtig widerständiges Denken für die Ausbildung von Erinnerungsdiskursen war – und es bis heute ist.
Haben wir also alles richtig gemacht und können stolz sein auf eine Erinnerungskultur, die erfolgreich in den deutschen Innenstädten und Parlamenten angekommen ist und sich darüber hinaus noch zum Exportschlager eignet? Dagegen spricht, dass momentan in denselben Parlamenten eine „Erinnerungswende“ gefordert wird, und durch ebendiese Innenstädte Pandemieleugner im Verbund mit Verschwörungsfanatikern und Rechtsradikalen marschieren und sich als Opfer einer „Corona-Diktatur“ begreifen, mit gelbem Stern an der Brust und Vergleichen mit Anne Frank und Sophie Scholl im Mund. Was ist falsch gelaufen, wenn gewaltsame antisemitische und rassistische Übergriffe zunehmen, wenn rechtsextreme Ideologien in Polizei und Militär kolportiert werden – ohne dass eine Gesellschaft sich geschlossen und solidarisch zur Wehr setzt? Oder wenn in der Woche des Internationalen Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus – und damit auch der als „Zigeuner“ verfolgten und ermordeten Roma und Sinti – in einer Talkshow darüber schwadroniert wird, dass an dem Begriff „Zigeunerschnitzel“ doch wirklich nichts Verletzendes sei. Hat der Geschichtsunterricht versagt? Oder verblasst die Erinnerung in einer Art natürlichem Vorgang, weil die zeitliche Distanz wächst? So wichtig ritualisiertes Gedenken ist, bleibt es doch inhaltsleer oder läuft Gefahr, instrumentalisiert zu werden, wenn sich keine Verantwortung für politisches Handeln, für Menschlichkeit und Empathie daraus ableitet.
Kürzlich wurde ich in einem Interview gefragt, ob nicht auch heutige Stätten jüdischer Kultur in Deutschland als Erinnerungsorte betrachtet werden müssten? Diese Frage enthüllt den Kern eines großen Problems unserer Erinnerungskultur. Denn Synagogen, Kulturzentren von Roma und Sinti oder auch queere Archive sind keine Erinnerungsorte der deutschen Verbrechen und Genozide – sie sind Symbole dessen, was vergessen wurde: die Geschichte der Diversität und Vielfalt vor 1933, die der Homogenisierungswahn der Nazis aus Bibliotheken, Museen, Archiven und dem Bewusstsein der Menschen „gesäubert“ hat, und die Kontinuität dieser Diversität nach 1945. Die Drohung, aus dem europäischen Gedächtnis gelöscht zu werden, war den Verfolgten nur allzu bewusst: Im Warschauer Ghetto fand sich eine Gruppe von Aktivist*innen um den Historiker Emanuel Ringelblum und sammelte alles, was an Dokumenten und Artefakten auffindbar war, um nicht nur die Geschichte des Ghettos und der Verfolgung zu dokumentieren, sondern auch die Geschichte des polnischen Judentums vor 1939. Bis heute finden sich viele Bücher, die Wolfgang Herrmann 1933 auf seine „Schwarze Liste“ aufnahm, nicht mehr in deutschen Bibliotheken, bis heute tauchen Jüdinnen und Juden in vielen Schulcurricula gar nicht oder nur als Verfolgte auf – nicht aber dort, wo ihr Platz wäre: im Zentrum der deutschen Geschichte als einer multiperspektivischen Erzählung. Diversität, gegenwärtige und vergangene, hat sich nicht adäquat in ein deutsches Kulturverständnis eingeschrieben, und es gilt, neue Erzählungen zu entdecken und vergessene Menschen zu feiern.
Um globale rechtsextreme Allianzen abzuwehren, brauchen wir eine offene Gesellschaft, in der Minderheiten ohne Vorbehalte geschützt werden und Anteil haben an demokratischen Prozessen und an Erinnerungsdiskursen – nicht als zu erziehendes Publikum oder gar als „Objekte“ in Sammelgebieten von Museen, Archiven oder Bibliotheken, sondern als aktive Träger*innen einer vielfältigen Kultur und Erinnerung.
Wir verwenden in unserem Magazin in unsystematischer Abfolge mal die grammatisch männliche und mal die grammatisch weibliche Form bei personenbezogenen Substantiven im Plural. In diesem Text weichen wir auf Wunsch der Autorin davon ab. (Anm. d. Red.)